Einmal im Jahr kommt in Berlin jene Gruppe von Menschen zusammen, die sich der konventionellen Musik verwehren. Dann werden ein Wochenende lang die Vorstellungen von dem, was überhaupt Musik ist, auf die Probe gestellt. Nachdem man letztes Jahr eine improvisierte Ausgabe mit Ausstellung und kleinen Besuchergruppen aus dem Hut gezaubert hat, durfte das Atonal dieses Jahr wieder mit dem klassischen, dreitägigen Festivalcharakter in die Vollen gehen. Dafür hat man sich dann auch gleich ein besonderes Motto ausgedacht. Unter dem Namen X100 wurde der Komponist Iannis Xenakis geehrt, der dieses Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte. Der Grieche machte sich Mitte der 50er Jahre mit einer völlig neuen Form der Musik einen Namen und schwang sich, falls es so etwas überhaupt gibt, zu einem kleinen Star in der Neuen Musik auf. Eine passende Wahl, die gleich in mehrerer Hinsicht wie Faust aufs Auge zum Berlin Atonal passt.
Für mich war dieses Wochenende gleich von doppelter Spannung geprägt. Nicht nur die Erwartung, wie das Berlin Atonal die vielen Stücke von Iannis Xenakis umzusetzen vermag, auch das gesamte Spannungsfeld der Musikgeschichte wurde mir quasi direkt vor Augen und Ohren geführt. Von morgens bis in den späten Nachmittag saß ich im Seminar über die Motetten von Johann Sebastian Bach, bevor es am Abend ins Kraftwerk ging. Auf der einen Seite das, was gemeinhin als eine der höchsten Formen westlich tonaler Musik gilt, auf der anderen Seite die völlige Abkehr von allen bekannten Kompositionsformen.
Gebannt schaut man den Tag über in Partituren, in denen der alte Thüringer zwei Chöre mit unnachahmlicher Eleganz miteinander verwebt, bevor am Abend all diese Schönheit eingerissen wird. Berlin präsentiert sich zudem an diesem Wochenende von seiner besten Seite, wenn Mitte November das Konzept der Sonne so langsam im Gedanken verblasst und sich noch ein feiner Schneeregen dazu gesellt.
So stapfe ich also im Dunklen in Richtung Heinrich-Heine-Straße, während mir Chorzeilen wie „Der saure Weg ist mir zu schwer” noch durch den Kopf geistern und das protestantische Ätzen unter der Last des irdischen Seins verstärken. Doch all das ist mit der Ankunft im Kraftwerk wie weggeblasen, denn im wahrsten Sinne des Wortes betritt man einen neuen (musikalischen) Kosmos. Die Räumlichkeiten des stillgelegten Heizkraftwerks an der Köpenicker Straße sind nicht nur Heimat des Tresors, sondern auch einer der beliebtesten Orte für Berlins Kunstszene.
Das liegt nicht nur daran, dass die europäische Städteplanung die Büroflächen zum Heiligtum ausgerufen hat und Kulturorte dadurch immer seltener werden, sondern auch daran, dass die brutalistischen und kargen Mauern perfekt zu Berlins experimentellem Anti-Schick passen. Im Kontext von Xenakis wird diesem Raum zusätzlich noch eine deutlich größere Gewichtung zuteil. Denn der musikalische Rebell war hauptberuflich nicht etwa Komponist, sondern Architekt.
Am 29. Mai 1922 wird Iannis Xenakis als Sohn einer griechischen Familie in der rumänischen Hafenstadt Brăila geboren. Seine Eltern führen ihn schon früh an die klassische Musik heran. Um 1938 zieht er nach Athen, wo er später Ingenieurwissenschaften studiert. Parallel zu seinem Studium führt er aber auch seinen Musikunterricht fort. Wenn auch immer mehr widerstrebend, beschäftigt er sich mit klassischer Harmonielehre – Kontrapunkt und allem, was die westliche Musiklehre zu ihrem Standardrepertoire erkoren hat.
Sein widerständiges Wesen zeigt sich in dieser Zeit aber weitaus deutlicher in anderen Bereichen. Als Mitglied der kommunistischen Partei kämpft er gegen das faschistische Italien und die Nazis, nach dem Krieg dann gegen die neue konservativ-monarchistische griechische Regierung und die Briten. Von einer Granate mit einer tiefen Wunde im Gesicht gezeichnet und in seiner Heimat zum Tode verurteilt, flieht Xenakis 1947 nach Paris.
Hier begegnet er zwei Personen, die besonders wichtig für seine Kunst sein sollten. Zum einen findet er eine Anstellung bei dem revolutionären Architekten Le Corbusier. Dessen propagierte Ingenieur-Ästhetik dürfte bei Xenakis auf besonders fruchtbaren Boden gefallen sein, befindet er sich doch selbst zwischen den Stühlen der Musik und Architektur. Auch Le Corbusiers Fokus auf den Goldenen Schnitt oder Fibonacci-Zahlen finden Ausdruck in Xenakis erstem musikalischen Werk ‘Metastaseis’.
Architektonisch erschaffen die beiden gemeinsam unter anderem 1958 den Philips-Pavillon, der nahezu gänzlich aus Formen besteht, die auch aus einem Walter-Moers-Buch stammen könnten: hyperbolische Paraboloiden. Zum anderen trifft er aufden Komponisten Olivier Messiaen, der sein Lehrer werden soll. Messiaen ist offen für Xenakis radikale und unkonventionelle Vorstellungen von Musik, erschuf er selbst doch völlig neuartige Tonreihen, die er auf Zahlenspielen, Gregorianik oder dem Gesang der Vögel aufbaute.
Unter diesen Einflüssen entsteht schlussendlich Xenakis neues Musikkonzept, das sowohl mathematische Berechnungen und das architektonische Flächendenken als auch den avantgardistischen Geist der aufkommenden 50er Jahre vereint. Was sich jetzt angesichts eines solchen Lebenslaufs so spannend liest, mündet dann aber in dem fast schon drögen Begriff der stochastischen Musik. Das erklärte Ziel des Griechen war es, Musik mit möglichst wenigen kompositorischen Regeln zu erschaffen.
Klangfarbe, Länge der Sequenzen, Tondauer und -höhe – alles soll nach den Mitteln der Wahrscheinlichkeitsrechnung ausgewählt werden. Und Xenakis wäre nicht Xenakis, wenn er damit nur gegen das gewohnt Tonale rebellieren würde. Er stellte sich mit seiner „Zufallsmusik” gleich auch noch gegen jene Anhänger:innen der seriellen und 12-Ton-Musik, die sich zu jener Zeit selbst als avantgardistischen Gegenentwurf hielten.
Musik im Verbund mit Architektur, die sich zudem noch völlig von allem Bekannten lossagt? Ein Match made in heaven für das Berlin Atonal. Ob der Architekt Xenakis die Halle des Kraftwerks gut fände, bleibt Spekulation. Für seine Werke jedenfalls ist der Aufbau des Raumes wie geschaffen. Aber nicht nur klanglich war das Räumliche dieses Jahr eine große Stärke des Atonal. Die Musik wurde als ein nahezu konstanter Fluss konzipiert. Mehrere kleine und spärlich aufgebaute Bühnen dienten für die verschiedenen Werke und Auftritte der Künstler:innen.
So mischten sich Kompositionen von Xenakis nahtlos mit denen der anderen Musiker:innen und wirkten fast wie eine begehbare Gesamtperformance. Spielt sich Xenakis Musik vornehmlich im zentrierten und stillem Lauschen des Konzertsaals ab, stellte das Atonal dem einen kollektiv erfahrbaren Festivalcharakter entgegen. Ein erfrischender Ansatz, der dem avantgardistisch anmutenden Vibe des Berlin Atonals doch eine wunderbare Lockerheit verpasste.
So stehe ich also vor der Bühne und lausche einem von Xenakis geschriebenem Werk für Chor, eine wirklich empfehlenswerte Erfahrung am Rande des Wahnsinns, bevor es dann im nächsten Augenblick elektronisch wird. Mal spielt ein Streichsextett, mal wirft Moritz von Oswald einen kurzen Impuls in den Raum, oder Valentina Magaletti tobt sich an den Drums aus. Ganz im Sinne des Berlin Atonal kommt dabei in den drei Tagen nichts im herkömmlichen Sinne „Schönes” dabei raus. Ohne ihm im negativen Sinne das Künstlerische absprechen zu wollen, werfen so einige Werke von Iannis Xenakis bei mir dann doch die Frage auf, ob es sich dabei überhaupt noch um Musik handelt.
In den großen Momenten hingegen stellt die Grenzerfahrung Berlin Atonal für kurze Zeit die eigenen Vorstellungen gehörig auf den Kopf. Einer davon gehörte der Christian Benning Percussion Group, die das vierteilige Werk ‘Pléïades’ aufführte. In 45 Minuten werden verschiedene Gruppen des Schlagwerks in den Fokus gerückt und von sechs Perkussionist:innen gespielt. Metallische Geräusche schneiden sich, teils am Rande der Erträglichkeit, ins Ohr, werden von wirren und wuseligen Xylofonen abgelöst und im bebenden Finale dröhnen dann tiefe Trommeln durch das gesamte Kraftwerk.
Musik in seiner physischsten Form. Nicht minder physisch und zusätzlich noch an der Kante zum Trip war Sergio Luques Aufführung von ‘La Légende d’Eer’. Angefangen bei einem schrillen Pfeifen, durchhören wir verschiedene Phasen, in denen unterschiedliche klangliche Charakteristiken aufgebaut und ausgekundschaftet werden, bis sie wieder in sich zusammenfallen.
Massen, Flächen, Wolken oder sogar Galaxien nannte Xenakis diese einzelnen „Sinnabschnitte”, mit denen seine stochastische Musik einen gewissen Halt oder Zusammenhang bekam. In besonders dichten Wolken brodelt und donnert es dann in der gesamten Halle. Der Raum füllt sich mit dichtem Rauch, die Lichter projizieren kleine Galaxien in das Dickicht und ich fühle mich wahrlich so, als wohne ich gerade der Schöpfung eines Universums bei.
Partikel krachen aufeinander, schwirren zufällig umher und setzen Energie frei. Dafür muss man das Berlin Atonal dann doch einfach lieben, wenn kompromisslos alles aus dem Kopf gebürstet wird, was man über Musik zu wissen meint. Und so gehe ich schlussendlich nach Hause und freue mich schon darauf, welcher Krach mir nächstes Jahr wohl präsentiert wird. Bis dahin werden allerdings doch eher schöne Bach Motetten gehört.
Abschließend muss hier aber, postscriptum, einmal die Chance für eine kleine Generalkritik ergriffen werden. So ist es vielleicht jetzt an der Zeit, dass die experimentelle elektronische Musik ihre großen Subwoofer sicherheitshalber mal für einige Jahre im Schrank verschließt und sich von dem omnipräsenten Stilmittel des konstanten Subbass-Drone trennt. Das durchgehende Gebrumme scheint mittlerweile Pflicht zu sein und wirkt fast schon ängstlich. Angst vor einer allzu großen Stille. Dabei liegt doch in der Stille oder der musikalischen Pause noch so viel, das es kompositorisch zu ergründen gibt.

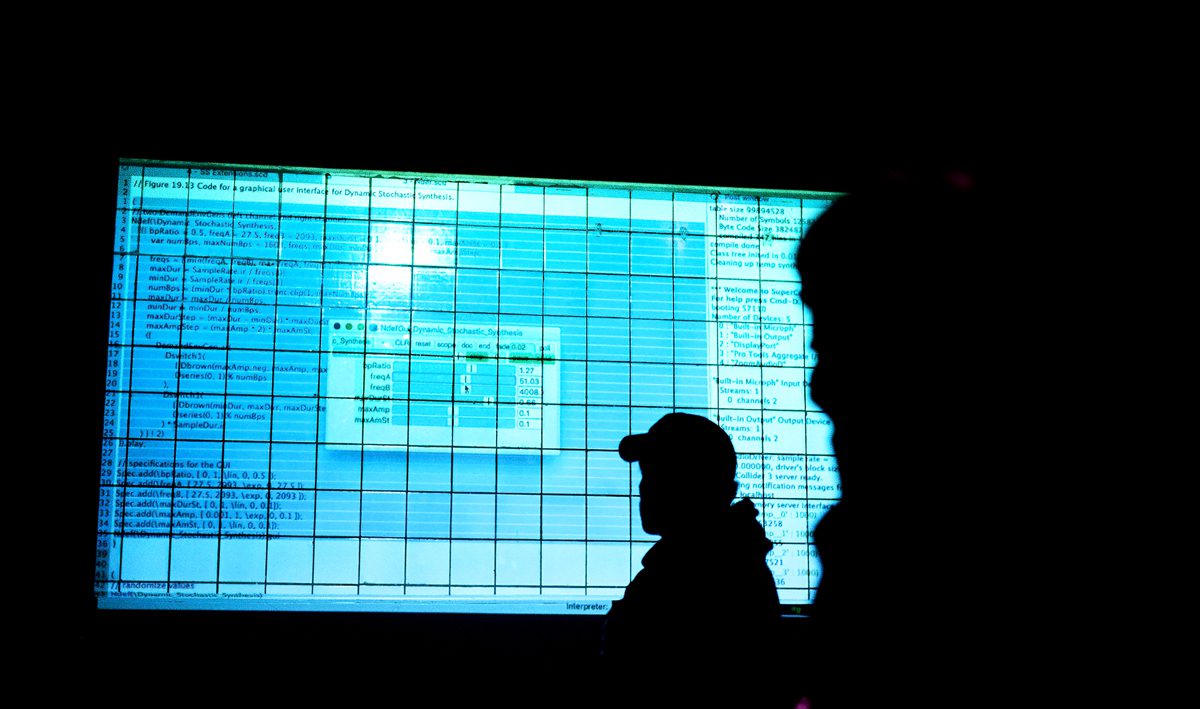







0 Kommentare zu "Tripbericht: Berlin Atonal X100 – Iannis Xenakis"