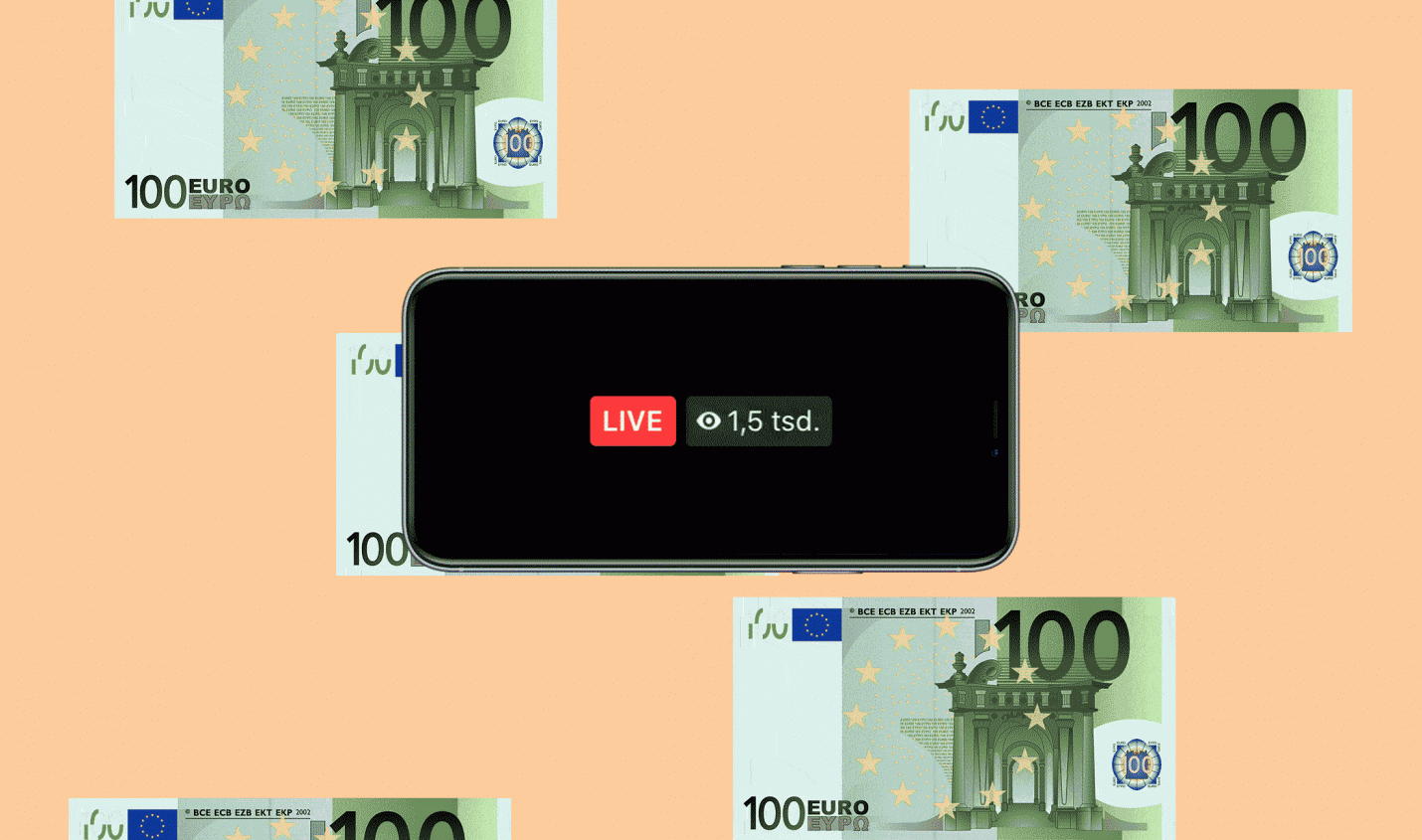
Bruchstelle: Solidarität und Spenden per Livestream – eine kritische Betrachtung
Die Clubs sind dicht, Festivals wurden abgesagt. Die Szene? Zwangspausiert nicht etwa, sondern zeigt ihre Solidarität und sammelt per Livestream fleißig Spenden. Doch erreicht diese Solidarität nicht alle. Und das verweist auf ein größeres Problem.
Es steht fest: Der Festivalsommer ist abgesagt. Wann und unter welchen Bedingungen Clubs wieder öffnen können, ist derzeit noch unklar. Mehr noch brechen die Fundamente der Musikindustrie ein. Nicht nur die aktuelle Gesamtsituation, sondern auch die Zukunft sieht düster aus. Für mindestens ein halbes Jahr wird unsere Subkultur stillstehen, Tausende sehen sich deshalb in ihrer Existenz bedroht. Welchem Festival könnte es nach einem Jahresausfall gelingen im Folgejahr wieder stattzufinden – zumal nicht feststeht, ob dies in epidemiologischer Hinsicht ratsam sein wird? Welcher Club kann es sich leisten, den Betrieb für ein halbes Jahr einzustellen und damit auf jede mögliche Einnahme zu verzichten? Was macht das kurz- oder langfristig mit DJs, deren Tourpläne gestrichen wurden? Überhaupt: Einigen Prognosen zufolge steht uns eine weltweite Rezession bevor, es wird sogar von einer Depression gesprochen. Das würde unweigerlich bedeuten, dass weniger Geld in die Clublandschaft gesteckt wird. Es steht fest: Die gesamte Szene steht haarscharf vor dem wirtschaftlichen Kollaps.
Aber es gibt Hoffnung. Denn die gibt es immer, wo Solidarität gezeigt wird. Und das wird sie! Denn mit Livestreams sammeln DJs Geld, um Clubs und Community zu unterstützen. Gemeinsam streamt sich die Clubwelt gesund, hat es den Anschein. Der Eindruck jedoch täuscht.
Denn so wie die COVID-19-Pandemie die global bestehenden Ungerechtigkeiten nicht bedingt, sondern lediglich schärfer hervortreten lässt, so tut sie das auch im Mikrokosmos unserer Subkultur. Wo gestreamt wird, mag derzeit sicherlich Geld fließen. Doch nicht etwa in Richtung derer, denen wir überhaupt die Musik zu verdanken haben und die massiv von der Krise bedroht werden. Obwohl die Streaming-Plattformen und die Major-Labels seit geraumer Zeit schwarze Zahlen melden konnten, lebten die meisten MusikerInnen bis vor der Coronakrise eben nicht von ihren Aufnahmen, sondern vorrangig von Einnahmen aus dem Live- beziehungsweise DJ-Geschäft oder Merchandise, soll heißen: sowieso schon prekär. Diese provisorischen Einnahmequellen sind nun auch weggebrochen.
Schon zuvor zeichnete sich die Welt der Dance Music durch einen bizarren Grundwiderspruch aus. In den vergangenen zwanzig Jahren haben die DJs den ProduzentInnen langsam aber sicher den Rang als eigentliche Stars der Szene abgelaufen und darüber auch als NutznießerInnen von deren wirtschaftlichen Strukturen. Einige Menschen reisen durch die Welt, um innerhalb weniger Stunden mithin fünfstellige Beträge oder sogar noch mehr zu verdienen – größtenteils oder ausschließlich mit der Musik von anderen Menschen, die wiederum derweil zu Hause sitzen und hoffen, dass hin und wieder jemand eine Platte kauft, die eigene Musik millionenfach gestreamt wird oder dass der neu gestartete Patreon- oder Mixcloud-Select-Kanal etwas abwirft.
Zugespitzt formuliert: DJs machen die Kohle, ProduzentInnen die Arbeit. So wichtig der Erhalt von Clubs als wichtige Versammlungsorte und soziale Katalysatoren regionaler Communitys sein mag, fragt sich also umso dringender: Sollten nicht diejenigen, ohne deren Arbeit es all dies gar nicht gäbe, genauso vor dem Ruin gerettet werden? Bei den zahlreichen Solidaritäts-Streams gehen sie nämlich weitgehend leer aus, sofern sie nicht als DJs mitmischen.
Mit viel Glück eine Monatsmiete
Das Problem der Wertschöpfung von Musikproduktionen ist kein neues, es verschärft sich dieser Tage jedoch im digitalen Raum. Livestreams offenbaren insbesondere im Fall von DJ-Sets, dass die inhärente Ungerechtigkeit der größeren Strukturen von der Subkultur mitgetragen wird. „Wenn du auf Instagram oder Twitch einen Livestream eines DJ-Sets mit mehreren Songs, die dir nicht gehören, aufsetzt, musst du dich technisch betrachtet im Falle jedes einzelnen Songs um eine Rahmenlizenz und Lizenz für die mechanische Vervielfältigung kümmern“, erklärte Cherie Hu in einer Ausgabe ihres Newsletters Water & Music die verzwickte Situation. Mehr noch würden mit der Bereitstellung des Streams nach Ablauf der Liveschalte – wie etwa bei Facebook der Fall – noch weitere potenzielle Lizenzgebühren anfallen.
Das heißt, dass sich DJs vor jedem Livestream um die rechtliche Seite kümmern sollten und idealerweise natürlich die von ihnen gespielte Musik an Verwertungsgesellschaften wie die GEMA oder GVL melden, die wiederum den MusikerInnen entsprechende Tantiemen ausschütten. Das tun die meisten aber schlicht nicht.
In einer perfekten Welt wäre es ganz einfach und die Plattformen würden automatisch erkennen, welche Musik gespielt wird, melden das einer Verwertungsgesellschaft und die lässt den SongwriterInnen beziehungsweise MusikerInnen das Geld dafür zukommen – während on top mit dem Livestreaming automatisch Geld für die bedrohten Clubs eingenommen wird. Doch so läuft es leider nicht. Das liegt einerseits an den Abkommen zwischen Plattformen wie Facebook und den Verwertungsgesellschaften, die sich wie im Falle von Facebook lediglich auf On-Demand-Videos beziehen und Livestreams nicht mit einschließen.
Das liegt sicherlich auch an den Verwertungsgesellschaften selbst, die alles andere als auf der Höhe der Zeit agieren: Die GEMA ist notorisch innovationsresistent und hat kein flächendeckendes System zur Erfassung von Musik in Clubs, geschweige denn im Neuland der sozialen Netzwerke parat. Und da wären noch DJs, die nicht aus eigenen Stücken aktiv werden und es versäumen, ihre Setlists bei den Verwertungsgesellschaften einzureichen – obwohl dies das Mindeste wäre, nachdem sie einen Großteil der von ihnen gespielten Musik in Form von Promos kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen haben.
Freilich gab es auch einige Aktionen, die ProduzentInnen zugutekommen. Bandcamp verzichtete beispielsweise am 20. März medienwirksam auf seine Gebühren – 15 % für Files, 10 % für Merchandise – und veröffentlichte danach eine Meldung, laut der an diesem Tag 4,3 Millionen US-Dollar über die Plattform eingenommen wurden. Geld, das direkt an die KünstlerInnen ging. Super!
Nur ist eine solche Summe nicht mehr ganz so beeindruckend, wird sie durch die nicht gerade kleine Anzahl der auf Bandcamp vetretenen Bands und Artists geteilt. Für einige Glückliche wird vielleicht eine Monatsmiete herausgesprungen sein, in den meisten Fällen war es aber wohl kaum mehr als ein halber Wocheneinkauf oder ein Trostgroschen. Die langfristigen Ausgaben und vor allem die anstehenden Einbußen – sei es durch Absagen im Live-Geschäft ebenso wie im ebenfalls in Mitleidenschaft gezogenen Bereich der Tonträgerproduktion – werden auch mit einer Wiederholung dieser wohlmeinenden Aktion am 1. Mai sicherlich nicht kompensiert.
Netflix statt Musik, alles für die Clubs!
Zuletzt also scheint auch das Publikum in Hinsicht auf die movers and shakers ihrer Szene nicht sonderlich weiterhelfen zu können – oder zu wollen. Tatsächlich wird dieses in Zukunft noch weniger in die Arbeit von ProduzentInnen investieren, wenn die wirtschaftlichen Konsequenzen der COVID-19-Pandemie erst einmal merklich werden. Laut einer in den USA durchgeführten Studie werden Musikfans dort am ehesten auf ihre Audio-Streaming-Abos verzichten, das wenige Geld wird stattdessen in Netflix und Co. investiert. Auf Musik muss anders als auf exklusive Video-Angebote schließlich niemand verzichten. Die gibt es ja für umme von den besten DJs der Welt im Facebook-Stream live gemixt. Gelebte Gratiskultur zeigt im Musikbereich spätestens jetzt ihr hässliches Gesicht.
Immerhin für die Clubs wird sich (noch) finanziell eingesetzt. Doch lohnt auch dort bei den Spendenaktionen der Blick aufs Kleingedruckte. Die Einnahmen aus dem gestaffelten Spendensystem von Resident Advisors Projekt Club Quarantäne beispielsweise gehen lediglich an die beteiligten Clubs, Promoter*innen und DJs und werden nicht etwa unter allen Clubs aufgeteilt oder gar den ProduzentInnen zugeführt. Wer darüber entscheidet, welcher Club und welche DJs beim Club Quarantäne vertreten sind und daher mit Einnahmen rechnen können, steht indes nirgendwo geschrieben.
United We Stream immerhin hat sein – ebenfalls auf Spenden basierendes – System augenscheinlich paritätischer organisiert. „Alle Einnahmen der Streams fließen in einen Rettungsfond, mit dem notleidende Clubs unterstützt werden können“, heißt es auf der Homepage der Aktion. „Für Ausschüttungen des Rettungsfonds hat die Clubcommission Berlin e.V und Reclaim Club Culture einen Kriterienkatalog entwickelt und eine unabhängige Jury beauftragt.“ Zumindest in Berlin klappt das also wohl und die Live-Ausstrahlung sowie Bereitstellung on demand durch den öffentlich-rechtlichen Sender arte impliziert zumindest, dass für die dort gespielte Musik in der Theorie Geld an die MacherInnen ausgeschüttet wird. Doch eine wirkliche Lobbybewegung für den ihnen zustehenden Support gibt es derzeit nicht.
Initiativen wie Mixcloud Live lassen immerhin ein Problembewusstsein durchscheinen, ändern aber noch nichts an der global sich bietenden Situation – sondern stellen wieder nur eine Plattform als etwas ethischer als die anderen in den Vordergrund. Solidarität als Marketingmittel, na danke. Besonders zynisch scheint da die Einführung der Artist Fundraising Pick genannten Spendenfunktion auf Spotify – einem Unternehmen, das zuletzt zwar Geld an die Musik-Community gespendet hat, sein gesamtes Geschäftsmodell aber auf der Entwertung von Musik aufgebaut hat. Es sollte aber aktuell nicht um die werbewirksamen Einsätze von Multinationals gehen. Sondern ums Ganze, das heißt eine völlige Umstrukturierung von Strukturen, die maßgeblich auf (Selbst-)Ausbeutung fußen.
Strukturelle Ungerechtigkeit statt Solidarität
ProduzentInnen stellen sicherlich nur eine von vielen verschiedenen Säulen dar, auf denen die Clubkultur im Gesamten ruht und sowohl Club Quarantäne als auch United We Stream können unmöglich alle strukturellen Übel gleichzeitig angehen. Doch zeigt sich am Beispiel der MusikerInnen, wie die angeblich szeneweite Solidarität strukturelle Ungerechtigkeiten reproduziert. Die Community ist allemal nicht direkt an diesem Schlamassel schuld, denn eine wirkliche Änderung der Verhältnisse kann nur von oben erfolgen: Die Plattformen müssen genauso in die Verantwortung genommen werden wie die Verwertungsgesellschaften grundlegend reformiert oder gleich zugunsten eines neuen, dezentralisierten Systems abgeschafft werden sollten.
Wie könnte das aussehen? Blockchain-Technologie, sogenannte Smart Contracts: Mittel für eine gerechtere Form von (Um-)Verteilung im digitalen Raum sind allemal da, nur an den legalen und infrastrukturellen Grundbedingungen muss gearbeitet werden. Und da ist in erster Linie die Politik gefragt, die sich weit über ein paar Lippenbekenntnisse zur Clubkultur hinaus für gerechtere ökonomische Verhältnisse einsetzen muss. Auch dazu allerdings braucht es ein Umdenken bei den DJs, in der Szene und beim Publikum, das auf eben diese Politik Druck ausüben muss. Solidarität ist wichtig, richtig und gerade in Krisenzeiten wie diesen unerlässlich. Und obwohl sie nie total und allumfassend sein kann: Solange sie auf einem Auge blind ist, wird sie strukturelle Probleme weiter nur reproduzieren, statt sie zu lösen.


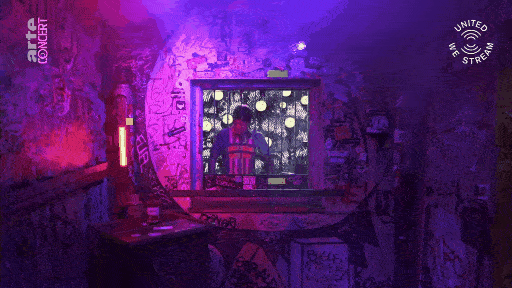
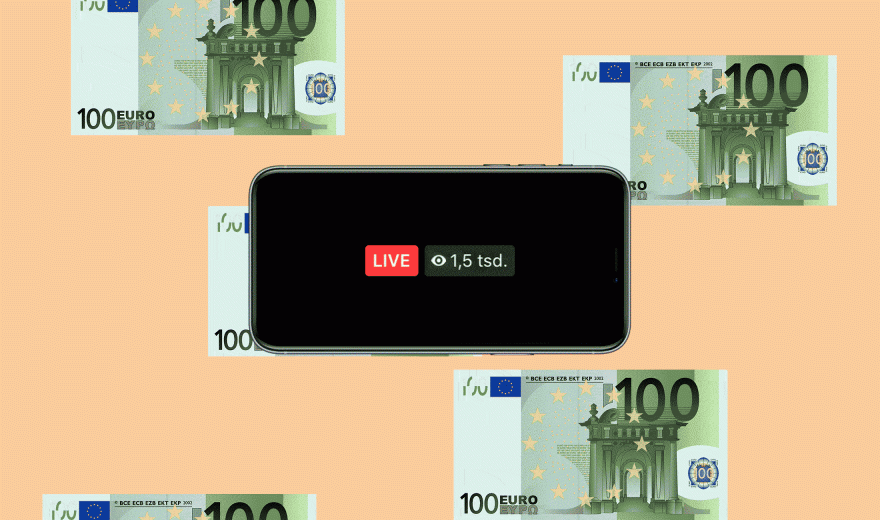

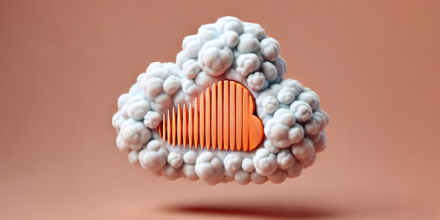

6 Kommentare zu "Bruchstelle: Solidarität und Spenden per Livestream – eine kritische Betrachtung"
You’ll find it near unattainable to encounter well-updated men or women on this issue, but you come across as like you understand whatever you’re writing on! Thanks
Hinterlasse eine Antwort
Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.
Fine way of describing, and pleasant piece of writing to get information concerning my presentation subject
Hinterlasse eine Antwort
Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.
This is the right blog for anyone who wants to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want…HaHa). You definitely put a new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, just great!
Hinterlasse eine Antwort
Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.
Some genuinely good information, Glad I found this. “O tyrant love, to what do you not drive the hearts of men.
Hinterlasse eine Antwort
Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.
I simply could not go away your website prior to suggesting that I actually enjoyed the standard info a person provide for your visitors? Is going to be again continuously in order to check out new posts
Regards
Ross Alisha
Hinterlasse eine Antwort
Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.
Sehr guter Artikel! Stößt spannende Gedanken an. Corona macht generelle Strukturprobleme wunderbar gut sichtbar. Für alle Problemlöser da draußen tut sich ein Paradies auf, denn die Rätsel sind über der Oberfläche des "halbwegs-funktionierens" aufgetaucht. Ich habe auch das Gefühl etwas dagegen oder dafür tun zu wollen, politischer zu werden. Golow (Musiker und Musikproduzent)
Hinterlasse eine Antwort
Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.