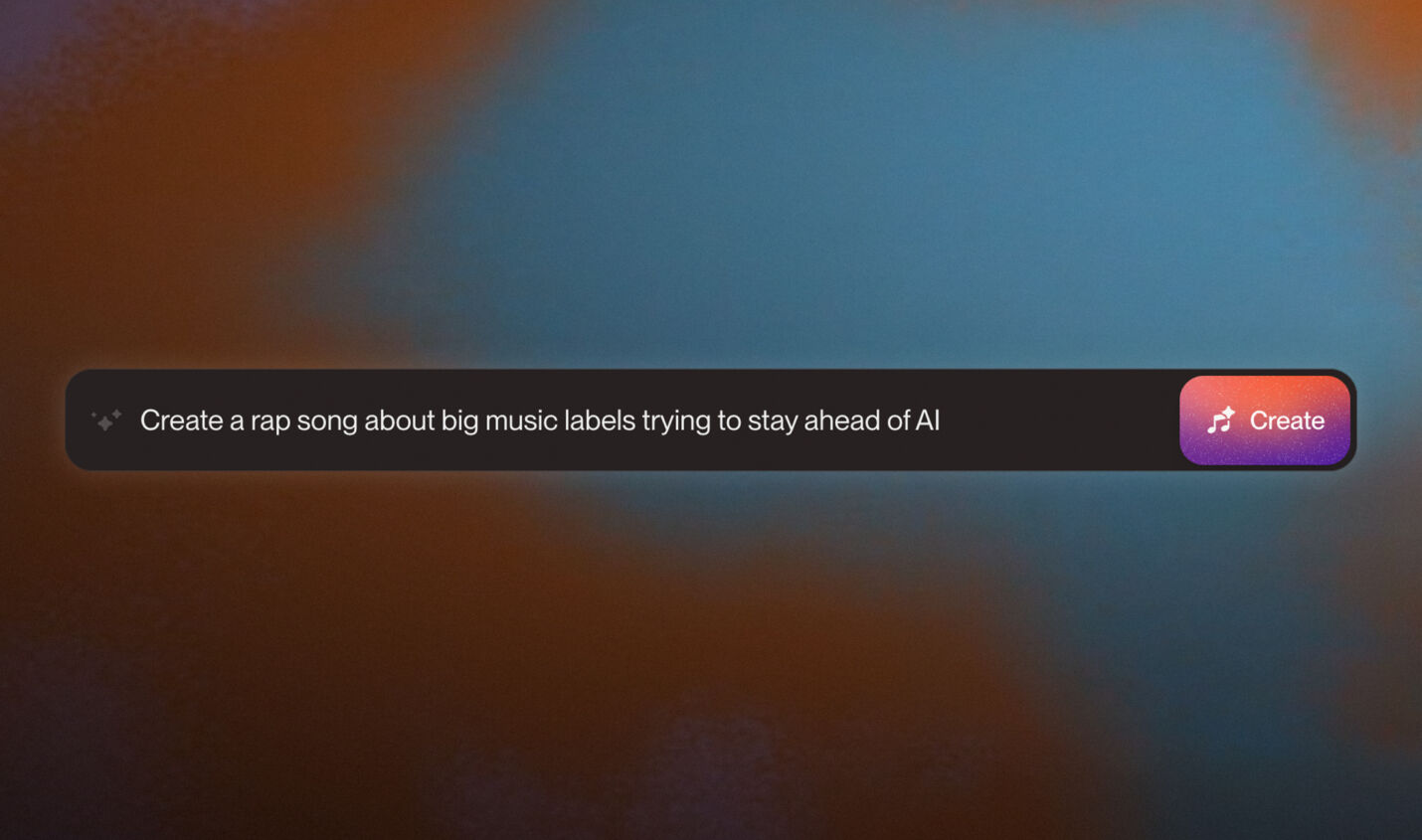
KI und die Musikindustrie: Ein Napster-2.0-Moment? Nope! – Quartalsbericht 2/2025
Ob GEMA oder die Big Three, allen voran die Universal Music Group: Die Musikindustrie reicht derzeit Klage über Klage gegen Anbieter von KI-Musikprogrammen wie Suno, Udio und OpenAI ein. Pure Hilflosigkeit? Wiederholt sich das Napster-Debakel der Jahrtausendwende? Überhaupt nicht, kommentiert Kristoffer Cornils in seiner Kolumne "Quartalsbericht": Das Ganze hat Methode.
In dieser Kolumne war zuletzt vor etwas weniger als zwei Jahren ausführlich von sogenannter Künstlicher Intelligenz im Kontext der Musikwelt die Rede. Nun hat das Thema allerdings die Clubszene erreicht und es mehren sich die Rechtsstreite zum Thema – allein die deutsche GEMA strebt derzeit zwei Prozesse an, einen gegen Suno und den anderen gegen OpenAI. Höchste Zeit, sich mal wieder genauer mit dem Thema zu befassen und die dringendsten Fragen zu beantworten.
Wurde (oder wird) irgendwer von KI-Musik "ersetzt"?
Anlass der letzten Quartalsbericht-Ausgabe zum Thema KI war der Fake-Drake-Song 'Heart on my Sleeve'. Dabei handelte es sich um ein Stück des Komponisten Ghostwriter, der den Song geschrieben und produziert hat, selbst die Lyrics wurden von einem Menschen eingesungen. Anschließend wurde lediglich der Gesang dank assistiver KI umgemodelt, sodass die jeweiligen Parts nach Drake und The Weeknd klangen. Innerhalb der letzten zwei Jahre scheinen weder der eine noch der andere Schaden davongetragen zu haben – 'Not Like Us' hat Drake schon eher zugesetzt.
Der Beef zwischen Drizzy und Kendrick Lamar ist ein Beispiel dafür, warum zumindest im Mainstream niemand einfach so durch KI "ersetzt" werden wird. Denn zwar kann mittlerweile potenziell jede:r einen epischen, zerstörerischen Drake-Diss mit der Stimme von Kendrick herstellen und vertreiben – würde das aber ernsthaft jemanden interessieren? Popkultur braucht echte Menschen als Identifikations- und Projektionsfiguren, Skandale wie die Schlagabtäusche zweier Rapper lassen sich nicht so einfach mit OpenAI, Suno oder Udio synthetisieren.
Aus einem ähnlichen Grund ging auch der mithilfe von KI zusammengeschusterte "letzte" Beatles-Song recht schnell nach Veröffentlichung wieder unter: Wenn im Video plötzlich die Avatare von John Lennon und George Harrison auftauchen, bekommt das einen mehr als sonderbaren Beigeschmack. Ebenso entpuppte sich der kurze Aufreger um "Verknallt in einen Talahon" als übertrieben. Ja, die Musik war mittels Udio synthetisiert worden, aber der Text kam aus menschlicher Hand. Der Song wurde außerdem primär als Meme und nicht als Musikstück konsumiert, die Musik war austauschbar.
Neben diesen drei Beispielen gab es in den vergangenen zwei Jahren kaum mehr KI-Musik, die Wellen schlug. Zwar wurden sie heiß diskutiert, doch waren sie nur bedingt kommerziell erfolgreich – was bedeutet, dass sie gar nicht so viel gehört wurden. Heißt das allerdings, dass sich die Musikwelt in Sicherheit wähnen kann? Nicht unbedingt. Denn bestimmte Musik kann unter bestimmten Umständen durchaus verdrängt werden.
Wessen Arbeit wird anderweitig durch KI bedroht – und wie?
Eine meiner Faustregeln für die Diskussion um die möglichen Auswirkungen der flächendeckenden Zugänglichkeit von KI-Programmen lautet: Bestimmte Berufsfelder sind nur sekundär davon bedroht, wie viel "klüger" KI wird. Gefährlicher ist, wie dumm potenzielle Auftraggeber:innen sind. Wenn die nämlich meinen, sie könnten menschliche Expertise und das notwendige Feingefühl für kreative Tätigkeiten mittels wild halluzinierender KI-Angebote wegautomatisieren, wird es durchaus problematisch.
Das betrifft vor allem die Art von Musik, die als Library oder Stock Music bekannt ist: Unauffällige und doch wohlklingende Sounds, die im Hintergrund von vor allem audiovisuellen Inhalten eingesetzt werden – vom TikTok-Video angefangen bis hin zu größeren Filmproduktionen. Damit finanzieren sich nicht wenige seriöse Komponist:innen den Lebensunterhalt. In Zukunft wird es zweifellos schwieriger für sie werden, weiterhin die Miete zahlen zu können, weil der Prozess zumindest potenziell automatisiert werden kann.
Das lässt sich um stimmungs- oder aktivitätsorientierte Musik erweitern – Playlist-Futter. Ambient und instrumentelle Klaviermusik steht dank Plattformen wie Spotify eigentlich hoch im Kurs, nur ist das für viele echte Musiker:innen längst nicht mehr so profitabel wie einst. Wie die Journalistin Liz Pelly unlängst bewies, sorgt Spotify bereits seit einer Weile dafür, dass ihnen durch "Perfect Fit Content" Konkurrenz gemacht wird. Nun könnte außerdem KI-Technologie den "passgenauen Inhalten" ihre Stellung streitig machen, nach dem Motto: Hey Suno, schreib doch bitte ein Klavierstück à la Nils Frahm zum Entspannen.
Die Flutung der Plattformen hat längst begonnen. Deezer meldete unlängst, dass dort 10.000 vollständig KI-generierte Stücke am Tag hochgeladen würden, und die Sony Music Group gab jüngst an, mittlerweile schon 75.000 "Deepfakes" von Sony-Artists auf den verschiedenen Diensten identifiziert zu haben. Beides sind deutliche Indikatoren dafür, wie mittlerweile gezielt versucht wird, die Plattformen mit KI-Inhalten zu füllen, um möglichst schnell ein bisschen Kohle zu machen. In Kombination mit Streaming-Manipulation beziehungsweise Clickfarming können dabei sogar Millionensummen zusammenkommen.
Das fix gepromptete Ambient-Stück oder der Ed-Sheeran-Klon "ersetzen" nicht die Musik, anhand deren Trainingsdaten sie synthetisiert werden. Wohl aber treten sie mit ihr in Konkurrenz, weil sie massenhaft auf die Plattformen gestellt werden mit dem Ziel, den Empfehlungsalgorithmus anzutriggern. Im Falle einer Plattform wie Spotify ist das ein durchaus selbstgemachtes Problem, denn gerade dieser Service hat maßgeblich an der Dekontextualisierung von Musik mitgewirkt. Damit hat es ein Publikum dazu erzogen, nicht immer aufmerksam hinzuhören.
Brauchen wir mehr Transparenz – und wie ist sie zu garantieren?
Eine andere meiner Faustregeln für die Diskussion über KI-generierte Musik lautet, dass die Unaufmerksamkeit oder gar Leichtgläubigkeit des Publikums das eigentliche Kapital aller systematischen KI-Scams darstellt. Das bewies zuletzt im Clubmusikkontext der Fall des YouTube-Kanals @Tobfunka und der Upload eines vermeintlich verschollenen Detroit-Techno-Albums, das sogar einige Menschen auf Bandcamp kauften. Manche von ihnen werden die Sache vielleicht als fingiert durchschaut haben, andere aber werden ihr auf den Leim gegangen sein.
Es wäre nun allerdings zu leicht, diesen Menschen Naivität vorzuwerfen. @Tobfunka inszenierte seine mutmaßlich KI-generierten Releases in einer Art und Weise, die an die üblichen Darstellungsformen vermeintlicher "heiliger Grale" der Digging-Kultur durch Reissue-Labels erinnerte. Wenn, und davon ist auszugehen, er all diese Musik tatsächlich mittels KI synthetisiert hat, hätte er das allein in moralischer Hinsicht transparent machen müssen. Aber wie sieht es eigentlich rechtlich aus? Trat nicht erst letztes Jahr auf EU-Ebene ein Gesetz in Kraft, durch das solche Täuschungen verhindert werden sollen?
Ja, aber nein. Der AI Act der EU bezieht sich maßgeblich auf die Anbieter von KI, das heißt in unserem Fall Firmen wie Suno oder Udio. Er definiert verschiedene Risikokategorien, aus denen sich unterschiedliche Pflichten für Anbieter ergeben – Musik wird dabei aber nicht dezidiert eingeordnet. Verstöße gegen das Urheberrecht könnten indes als besonders risikoreich gewertet werden, tatsächlich soll ein sogenannter Opt-Out ermöglicht werden. Zudem soll eine Transparenzpflicht greifen. Im Gesetzestext heißt es: KI-Output soll "in einem maschinenlesbaren Format gekennzeichnet (...) und als künstlich erzeugt oder manipuliert erkannt werden können."
Das ist denkbar vage formuliert, und was bedeutet es für Nutzer:innen von KI-Programmen? "Wer ein KI-System einsetzt, das Bild-, Audio- oder Videoinhalte erzeugt oder manipuliert, die einen Deep Fake darstellen, muss offenlegen, dass die Inhalte künstlich erzeugt oder manipuliert wurden", heißt es. Aber auch: "Ist der Inhalt Teil eines offensichtlich künstlerischen, kreativen, satirischen, fiktionalen oder analogen Werks oder Programms, so beschränken sich die (...) Transparenzpflichten auf die Offenlegung des Vorhandenseins eines solchen künstlich erzeugten oder manipulierten Inhalts in einer angemessenen Weise, die die Darstellung oder den Genuss des Werks nicht beeinträchtigt."
Auch das lässt womöglich Schlupflöcher offen. Denn was ist ein "analoges Werk oder Programm", inwiefern könnte eine Kennzeichnung "die Darstellung oder den Genuss" eines KI-generierten Stücks Musik "beeinträchtigen" und wie genau muss das "Vorhandensein" markiert werden? Das sind alles Fragen, die sich wohl erst nach und nach klären werden – und zwar vor Gericht, wo die Umsetzung von Gesetzen wie dem AI Act verbindlich auf die Probe gestellt werden muss. Noch geschieht das nicht, geklagt wird dennoch – und zwar weltweit.
Welche Klagen gegen KI-Anbieter gibt es?
Der derzeitige Moment erinnert bisweilen an das Napster-Zeitalter. Damals wie heute stellte eine neue Technologie Konkurrenz für die Musikindustrie in ihrem Kerngeschäft dar: Die massenhafte Verbreitung von illegalen Downloads ließ das CD-Geschäft einbrechen, heutzutage droht die massenhafte Flutung von Plattformen die Erträge aus dem Streaming zu schmälern. Damals wie heute machen sich die Anwaltskanzleien der Industrie daran, unter Berufung auf das Urheberrecht die Sache anzufechten. Mit einigen Unterschieden allerdings.
Die Universal Music Group (UMG) reichte gemeinsam mit einer Reihe von Musikverlagen im Herbst 2023 Klage gegen den KI-Anbieter Anthropic ein und verklagt mittlerweile zusammen mit den anderen beiden der sogenannten Big Three, Sony Music Entertainment (SME) und der Warner Music Group (WMG), Suno und Udio. Auch die deutsche Verwertungsgesellschaft GEMA klagt, einerseits gegen Suno und andererseits gegen OpenAI. Wiederholt sich hier Geschichte als Farce? Versucht die Industrie wieder einmal, sich mit allen Mitteln gegen den technologischen Fortschritt zu stemmen, damit bloß alles beim Alten bleibt?
Keineswegs. Hinter den Klagen steckt Methode, sie werden strategisch eingesetzt. Zum einen reagieren die Big Three oder Verwertungsgesellschaften wie die GEMA damit auf die recht langsam laufende und potenziell lückenhafte Gesetzgebung. Details des AI Act der EU werden weiterhin aus der Musikindustrie heraus kritisiert, ebenso wird gegen vergleichsweise sehr laxe Gesetzesentwürfe in Großbritannien protestiert. Auch in den USA wird befürchtet, dass die Legislative den KI-Firmen einen Blankoscheck ausstellen könnte. Gegen einzelne Anbieter vor Gericht zu gehen, könnte Verbindlichkeiten schaffen, wo die Gesetzgebung versagt.
Ein Beispiel für die Potenziale dieser Strategie ist der noch laufende Prozess von UMG und Co. gegen Anthropic. Die Klägerseite konnte einen ersten Teilerfolg erzielen: Anthropic hat sich verpflichtet, das hauseigene KI-Programm Claude mit sogenannten "guardrails" versehen, die die Reproduktion von urheberrechtlich geschütztem Material verhindern, obwohl die zuständige Richterin kürzlich ablehnte, Anthropic das Training an Material zu untersagen, an dem UMG und andere Rechte haben. In diesem Fall geht es um Textdichtung, also Lyrics, was konkret heißt, dass Claude nicht mehr in der Lage sein sollte, Beyoncé-Songtexte auszuspucken. Das wäre erst wieder möglich, wenn UMG es im Rahmen eines Lizenzabkommens explizit erlaubt – und dafür bezahlt wird.
Welche Ziele verfolgen die Klagen?
Die Klagen der Big Three oder der GEMA richten sich nicht gegen Nutzer:innen, sondern allein an den Anbieter. Das ist der erste Unterschied zum Napster-Zeitalter, in dem die Musikindustrie regelmäßig Oma Erna zur Kasse bat, weil Enkelchen Fritz über ihre IP-Adresse das neue Limp-Bizkit-Album von Kazaa gesaugt hatte. Der zweite ist, dass die Klägerseite offensichtlich nicht vorhat, Programme wie Claude vom Netz zu nehmen, wie das die Musikindustrie einst hinsichtlich Napster – mit Erfolg – anstrebte. Vielmehr geht es darum, die eigenen Verwertungsrechte zu sichern.
Denn auch wenn die meisten Investitionen weiterhin anderswo getätigt werden: Im Unterschied zu damals erkennt die Musikindustrie ein wirtschaftliches Potenzial in KI. SME etwa investierte jüngst in eine Lizenzplattform mit KI-Schwerpunkt und UMG arbeitet unter anderem seit Oktober letzten Jahres mit Klay zusammen, ein Anbieter von generativer KI. Vor diesem Hintergrund sind ihre Klagen gegen Anthropic sowie Suno und Udio noch einmal anders zu deuten. Suno etwa kollaboriert seit neuestem mit Amazon. Wenn UMG nun bewirken könnte, dass Alexa-Nutzer:innen nicht ohne Weiteres Songs im Stile von Beyoncé, Billie Eilish oder Taylor Swift per Sprachbefehl prompten können, würde das zum Wettbewerbsvorteil werden.
Denn noch ist Klay zwar nicht erhältlich, bei einem Launch würde es dem Publikum höchstwahrscheinlich aber die Synthetisierung von Musik ermöglichen, die an der Musik von UMG-Artists trainiert wurde. Claude darf nicht einfach Beyoncé-Lyrics ausspucken, über Klay ließen sich aber eventuell ganz neue Beyoncé-Songs prompten, die musikalisch und stimmlich nah am real deal sind. Und welche von Taylor Swift, Billie Eilish, The Weeknd, sogar Drake und Kendrick Lamar – wenn das denn, siehe oben, wirklich jemand will. Damit würde UMG nicht nur urheberrechtlich im Sinne der vom Unternehmen vertretenen Künstler:innen handeln, sondern könnte auch ihre Urheberrechte exklusiv verwerten.
Um die Verwertung von Rechten geht es ja auch der, na ja, Verwertungsgesellschaft GEMA. Ihre Klagen gegen Suno (dort in Bezug auf die Kompositionen) und OpenAI (hier liegt der Schwerpunkt auf Textdichtung) zielen auch nicht darauf ab, deren Angebote vom Netz zu nehmen. Vielmehr sollen sie Präzedenzfälle zu schaffen – hinsichtlich OpenAI ist sogar dezidiert von einer "Musterklage" die Rede. Auf ihrer Website schreibt die GEMA, sie wolle "damit ein Lizenzmodell, in dem das Training der Systeme, die Generierung von Output und die weitere Nutzung des Outputs lizenziert werden, am Markt etablieren." Es geht also darum, systematisch am Geschäft mit der KI-Musik mitzuverdienen.
Es gibt also keinen Napster-2.0-Moment, vielmehr hat die Musikindustrie aus eben jenem Desaster gelernt. Das hat sie ja schon vor langem. In seinem Buch "Streaming Music, Streaming Capital" verweist Eric Drott darauf, dass die großen Konzerne schon im anbrechenden Streamingzeitalter mit ähnlichen Klagen die neuen Plattformen an den Verhandlungstisch zwang. Heute will die Musikindustrie auf dieselbe Art bewirken, dass sie die Verwertung ihrer Rechte durch KI garantiert bekommt. Daraus spricht die Erkenntnis, dass sich der technologische Wandel nicht aufhalten lässt. If you can't beat 'em, join 'em.
Welche Aussichten haben die unterschiedlichen Klagen?
Bisher gibt es bezüglich Musik und KI noch keine Gerichtsurteile, die als Präzedenzfälle zitiert werden könnten. Auch werden Fragen des Urheberrechts in verschiedenen Ländern anders gehandhabt. Suno und Udio berufen sich beispielsweise im US-amerikanischen Raum auf die Rechtsnorm des Fair Use, die per se einen gewissen Spielraum erlaubt: Fair Use liegt dann vor, wenn Urheber:innen kein nennenswerter Schaden zugefügt wird beziehungsweise die maßvolle Verwendung von urheberrechtlichem Material einen öffentlichen Nutzen hat. Suno und Udio sagen nun: Das bloße Training an jedweder Musik erfüllt genau diese Kriterien.
Was aber als Fair Use gilt oder nicht, das wird im Einzelfall entschieden. Gerichte berücksichtigen dabei vier Faktoren: Den Zweck und Charakter der Verwendung, die Beschaffenheit des verwendeten urheberrechtlich geschützten Werks, die Anzahl oder das Ausmaß der verwendeten Teile sowie – und das ist in diesem Fall wohl der wichtigste Punkt – die Auswirkungen der Verwendung auf den potenziellen Markt. Fair Use stellt vor allem sicher, dass transformative Werke oder die zitatähnliche Verwendung von urheberrechtlich geschützten Materialien unter bestimmten Bedingungen straffrei erfolgen kann. Wenn allerdings Claude auf Prompt Beyoncé-Lyrics ausspuckt, ist das nicht gegeben – deshalb die "guardrails".
Musik erweist sich in urheberrechtlicher Hinsicht sowieso oft als streng gehandhabter Sonderfall, wie beispielsweise die Geschichte des Samplings sowie die Streitigkeiten um vermeintliche Plagiate oder sogenannte Interpolationen in den USA beweisen. Viele Urheber:innen konnten sich Rechteanteile an Hip-Hop-Produktionen erklagen, weil ihre Musik darin gesampelt wurde, und mit Urteilen wie zu Songs wie "Blurred Lines" von Robin Thicke wurden eher dünne Bezüge auf andere Songs geahndet. Vergleichbares ist auch aus Deutschland bekannt, wo der Fall Kraftwerk gegen Moses Pelham wegen eines zweisekündigen Samples nach 20 Jahren noch immer nicht abschließend entschieden ist.
Nun ist das Training an urheberrechtlich geschütztem Material freilich etwas anderes als das direkte Sampling von Musikaufzeichnungen oder Ähnlichkeiten in der Komposition eines Songs. Auch deshalb wird geklagt: Es soll Klarheit geschaffen werden, wie Training rechtlich eingeordnet wird, was die Richterin in der Anthropic-Klage explizit ablehnte. Es tut sich allerdings auch etwas in anderen Branchen. In den USA erhielt deshalb ein Fall viel Aufmerksamkeit, den der Medienkonzern Thomson Reuters für sich gewinnen konnte. Dabei ging es um Machine Learning in der Publizistik und nicht um generative Musik-KI – im Zentrum stand dennoch eine urheberrechtliche Frage. Das Urteil wird sicherlich in den Klagen von UMG und Co. künftig eine Rolle spielen.
Noch bleibt viel offen, obwohl es für die Musikindustrie durchaus Anlass zum vorsichtigen Optimismus gibt: Gerade in den westlichen Machtzentren der Musikwelt hat das Urheberrecht einen großen Stellenwert. Doch würden Landgewinne in diesem Bereich nicht der Flutung der Plattformen einen Riegel vorschieben. Die per AI Act zur Kennzeichnung ihres Outputs verpflichteten KI-Anbietern sind dabei ebenso gefragt wie die Plattformen sowie die sie beliefernden Vertriebe. Es wäre sinnvoll, wenn sie Schutzmechaniken zur Detektion und Entfernung von KI-Cashgrabs installieren. Aber wollen sie das?
KI-Detektion: Rettung in Sicht?
Als Deezer kürzlich verkündete, dass 10.000 der täglich auf die Plattform geladenen Musikstücke vollständig mit KI generiert wurden, war dies kein Moment der kleinlauten Selbstkritik. Vielmehr bewarb der französische Konzern damit über die Bande ein neues Werkzeug, das die Detektion von solcher Musik ermöglicht – ein sonderbarer Marketing-Stunt für eine Technologie, auf die Deezer zwei Patente angemeldet hat. Wieder einmal will ein Unternehmen nicht die Technologie als solche bekämpfen, sondern sich damit profilieren beziehungsweise davon profitieren.
Deezer ist vorsichtig genug, darauf hinzuweisen, dass sich all das nur auf "vollständig KI-generierte Musik" bezieht. Das lässt viel Spielraum: Ein "Fake Drake" wie der von Ghostwriter vor zwei Jahren würde darunter ebenso nicht fallen wie der aufpolierte Beatles-Song oder "Verknallt in einen Talahon". Auch habe das Tool eine hohe Erkennungsrate in Bezug auf Suno- oder Udio-Produktionen, beim Output anderer und vor allem neuerer Programme sei es schon nicht mehr ganz so verlässlich. Ganz so gute Nachrichten sind das im Endeffekt in mehrerlei Hinsicht nicht.
Hinzu kommt, dass Deezer die Stücke nicht einmal von der eigenen Plattform entfernt oder gar demonetarisiert. Vielmehr sollen sie lediglich nicht redaktionell oder algorithmisch empfohlen werden. Das heißt, dass vollständig mit KI-generierte Musik weiterhin auf Deezer bleibt und dass das Publikum sie weiterhin konsumieren kann, wenngleich es dafür proaktiv werden muss. Deshalb steht die KI-Flut zumindest bis zu einem gewissen Grad weiterhin in Konkurrenz zu "echten" Musiker:innen. Ironisch ist daran nicht allein, dass Deezer im Herbst 2023 noch ein als 'artist-centric' betiteltes Vergütungsmodell eingeführt hatte.
Die strategische Vorsicht, die Tech-Unternehmen wie Deezer und große Musikkonzerne walten lassen, ist bezeichnend – und mindestens ambivalent. Während sie sich vordergründig nicht dem technologischen Fortschritt in den Weg stellen wollen, geht es ihnen eben auch darum, bestimmte Verwertungspotenziale nicht im Keim zu ersticken, sondern für sich urbar zu machen. Freilich würde es wohl aber auch nichts bringen, in der Breite restriktiv und repressiv gegen KI vorzugehen. Das Kind ist doch schließlich schon in den Brunnen gefallen. Zumindest das hat der jetzige Moment mit dem Napster-Zeitalter gemein.
Was sonst noch wichtig war:
Amazon Music arbeitet ja mittlerweile mit UMG im Rahmen von "Streaming 2.0" zusammen und hat in diesem Zuge nun die Abopreise in den USA, Großbritannien und Kanada für das Unlimited-Angebot angehoben. Teil des "Streaming 2.0"-Pivots soll ebenso ein 'artistic-centric'-Ausschüttungsmodell werden, das Gerüchten zufolge wie bei Spotify selten gespielte Musiktitel demonetarisieren könnte. Heißt zusammengenommen: Mehr Geld für weniger Artists beziehungsweise deren Labels als zuvor – und somit weniger für alle anderen.
Concord ist eine weitere Firma, die ihren Einfluss im Vertriebsgeschäft ausweitet: Das auf die Verwertung von Musikrechten spezialisierte Unternehmen hat die Plattform Stem aufgekauft.
Live Nation hat im Jahr 2024 erneut Rekordsummen umgesetzt: Mehr als 23 Milliarden Euro flossen in die Kasse des US-amerikanischen Quasi-Monopolisten im Live- und Festival-Sektor. Die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten ließ die Firma wohl übermütig werden, laut CEO Michael Rapino befindet sie sich in Gesprächen mit den führenden Streamingplattformen, bei denen es wohl um "Streaming 2.0" beziehungsweise Superfan-Angebote gehen wird – mit SoundCloud kollaboriert die zu Live Nation gehörende Ticketing-Firma Ticketmaster schon seit neuestem (s. u.). Doof nur, dass die in den USA derzeit vom Department of Justice angestrebte Zerschlagung von Live Nation und Ticketmaster trotz neuer politischer Führung rechtlich weiterhin verfolgt wird.
Marshall hat für 1,1 Milliarden Euro Mehrheitsanteile des Gitarrenherstellers an die chinesische Investorgesellschaft HongShan Capital Group abgegeben. Endlich noch mehr Private-Equity-Geld im Gear-Markt!
Rokk, die deutsche Streamingplattform mit Fokus auf all things Gitarrenmusik, wurde endlich in Europa und Großbritannien ausgerollt. Ich bin gespannt, wie sich der Dienst bewährt und ob er sein Versprechen – höhere Auszahlung als bei der Konkurrenz dank Mut zur Nische – einhalten können wird. Mehr zum Konzept von Rokk habe ich vor einer Weile hier aufgeschrieben.
Qobuz schüttet nach eigenen Angaben 0,01802 Euro pro Stream an Rechteinhaber:innen aus. Der französische Streamingdienst ist damit der erste, der diesen – in der Regel nur auf Schätzungen beruhenden – Wert eigenständig öffentlich macht. Des Weiteren behauptet Qobuz, unter Nutzer:innen einen Pro-Kopf-Umsatz von 117,60 Euro pro Jahr zu generieren, was die vergleichsweise sehr hohen Ausschüttungen erklären würde – wie bei Spotify und Co. werden 70 Prozent der Einnahmen aus Abobeiträgen für Tantiemenzahlungen abgestellt. Der Dienst setzt seit Beginn auf hochqualitative Wiedergabe (Lossless und Hi-Res) sowie ein kuratiertes Programm und bietet zusätzlich zu Streamingfunktionen auch Downloads an.
SoundCloud macht nunmehr gemeinsame Sache mit Ticketmaster, dem Ticketing-Saftladen des Quasi-Monopolisten Live Nation (s. o.). Artist-Pro-Abonnent:innen können also in Zukunft über SoundCloud Tickets zu ihren Events verscheuern und damit das vampiristischste Unternehmen der Live-Branche damit mitverdienen lassen. Ja, nice.
Spotify-Geschäftsführer Daniel Ek hat seit Sommer 2023 über 724 Millionen US-Dollar mit dem Abstoßen von Unternehmensaktien verdient. Das ist möglich, weil der Börsenkurs nach dem ersten profitablen Jahr in der Unternehmensgeschichte weiterhin auf dem Höhenflug ist. Um noch mehr Geld reinzuholen, wird wohl in absehbarer Zukunft ein neues Abomodell nach "Streaming 2.0"-Prinzip ausgerollt, das neben verlustfreier Wiedergabequalität (also das, was bei fast allen anderen Teil des Basisprodukts ist) wohl auch Vergünstigungen beim Kauf von Konzerttickets umfasst. Ticketing beziehungsweise das Live-Geschäft ist ja sowieso das neue Lieblingsthema des Unternehmens, das sich davon wohl Einnahmen aus den riesigen Einnahmen von Live Nation und Co. verspricht. Mittlerweile informieren sogar algorithmisch kuratierte Playlists über bald in der Nähe gastierende Live-Acts. Das alles verspricht mehr Bequemlichkeit für die Fans und höhere Einnahmen sowie eine Festigung der Position des Marktführers, aber machen wir uns nichts vor: Beim aktuellen Wandel hin zu "Streaming 2.0" haben vor allem kleinere und mittelgroße Artists und ihre Labels das Nachsehen.
YouTube Music ist offensichtlich im Kommen: Vor Kurzem vermeldete der Streamingdienst von Alphabet, die Grenze von 125 Millionen Abonnements durchbrochen zu haben. Der Global Head of Music bei YouTube, Lyor Cohen, behauptet in einem aufschlussreichen Interview mit Tim Ingham von Music Business Worldwide, dass da noch mehr geht. Er mag Recht haben: Für Midia Research hat Hanna Kahlert eine interessante Analyse dazu geschrieben, warum YouTube insgesamt vor allem in nicht-westlichen Ländern einen dermaßen großen Stellenwert hat – das wird auch YouTube Music perspektivisch zum Vorteil gereichen.

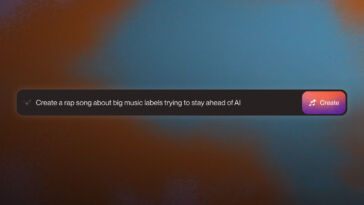



0 Kommentare zu "KI und die Musikindustrie: Ein Napster-2.0-Moment? Nope! – Quartalsbericht 2/2025"