
Künstliche Intelligenz im Musikjournalismus: Schluss mit den langweiligen Texten!
ChatGPT und alle so: yeah! Über den von Elon Musk mitgefundeten Sprachbot haben – von A wie Atlantic über S wie Spiegel Online bis hin zu bis zu Z wie Zillertaler Zeitung – so ziemlich alle Medien berichtet. Die einen beschwören mit dem „Bösewicht-Bot” unseren Untergang, die anderen sehen hinter der „Künstlichen Intelligenz” ein „verblüffendes Tool”. Viele zeigen sich „überrascht”, noch mehr sind „in Aufregung” und fast alle dürften in den letzten Wochen eine meganice Zeit gehabt haben – schließlich konnte man mit „witzigen und kreativen” Experimenten zeigen, dass der eigene Job noch Relevanz besitzt.
So haben wir mittelalterliche Gedichte über E-Scooter gelesen, ein Rap-Battle zwischen zwei medizinischen Untersuchungsverfahren verfolgt und gelernt, dass ChatGPT eine „stringent argumentierte Interpretation” von Karl Poppers Konzept der Theoriebildung in der Sozialwissenschaft liefern kann. Wen das alles interessieren sollte? Keine Ahnung! Mitgemacht hab ich trotzdem. Mein oscarreifes Filmskript über eine depressive Dreiecksbeziehung zwischen Dettmann, Klock und Nina Kraviz begrabe ich in den Hinterlassenschaften meiner Daten, die OpenAI, das Unternehmen hinter ChatGPT, gesammelt hat. Um das Modell „zu verbessern”, wie Quellen versichern.
Inzwischen haben ChatGPT über eine Million Menschen genutzt. Als Person, die mit Zeilen über Musik ihr Geld verdient, fällt mir auf: Die Möglichkeiten mit ChatGPT sind groß und die Menschen des Musikjournalismus auffallend leise. Es lässt sich kaum ein Artikel finden, der über die Potenziale berichtet. Haben die Leute Schiss, dass ein Bot die besseren Rezensionen, Artist-Biografien oder News-Artikel schreibt? Oder will niemand den einen Text darüber schreiben, wie mittelmäßig Musikjournalismus inzwischen geworden ist? Wie wenig unterhaltsam er ist? Warum er keine Kritik mehr äußert, die über das dateninduzierte Vermögen einer „Künstlichen Intelligenz” hinausreicht?
„Verwendet es wie ein Spielzeug, nicht wie ein Tool”, schreibt der intelligenteste Videospieldesigner unter den Akademikern: Ian Bogost. Sein Ansatz, ChatGPT einfach als „toy” zu verwenden, gefällt mir. Während literally alle ihre Arbeit abgeben, indem sie den Computer benutzen, um ihre Aufgaben zu erfüllen und danach drüber schreiben, dass sie Angst haben, Computer könnten unsere Arbeit abnehmen, sagt Bogost: „Nutzen wir das Ding doch einfach als Möglichkeit, mit der Welt zu spielen, oder besser: Um sie zu zerstören.”
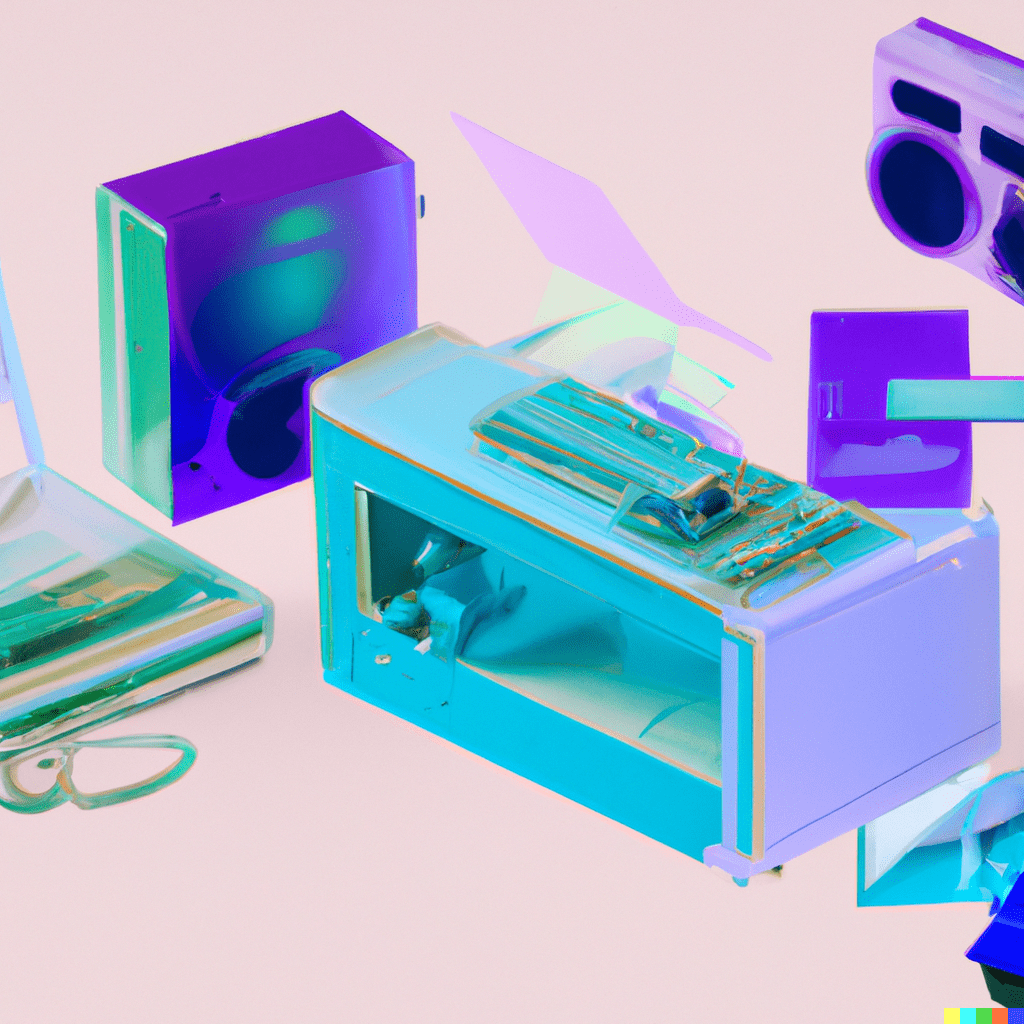
Weil ich als fauler Mensch gerne meine Aufgaben abgebe, um noch mehr rumzuspielen als sonst, wähle ich den wenig zerstörerischen Mittelweg. ChatGPT soll mir die Arbeit abnehmen und Rezension über ein Album schreiben, unter das ich meinen Namen setze, bevor ich das Geschwafel an ein Musikmagazin verkaufe. Die Anforderungen: Zwei Absätze über einen bestimmten Musiker, der gerade eine Dub-Techno-Platte releast hat. Und das alles bitte „in the style of myself: Christoph Benkeser”.
Damit kann das Programm natürlich wenig anfangen, denn: ChatGPT greift a) nur auf Daten von vor 2022 zurück. Es kann also keine aktuellen Bezüge zu Name und Titel eines gerade erschienenen Albums machen. Außerdem tendiere ich b) nur in Momenten der allerhöchsten Eisenbahn zu Größenwahn und Hybris. Das bedeutet c), dass das „toy” meine Schreibe mit anzunehmender Sicherheit nicht kennt. Als fauler und – ich ergänze – tendenziell uneitler Mensch, ist mir das aber völlig wurscht. Ich will meine 14 Euro Zeilengeld. Ohne Arbeit. Für lau. Now!
Ich reduziere also die Anforderungen, die ich an ChatGPT stelle. Den Namen des Interpreten gebe ich zwar weiterhin vor, aber: Es soll einfach eine Rezension zu einem Dub-Techno-Album werden. Schließlich klingen die seit Basic Channel ohnehin alle wie Äpfel aus dem Supermarkt schmecken. Wem soll der Betrug also auffallen, denke ich und lasse mir zwei Absätze über eine Platte ausspucken, die weder ich noch das Programm je gehört haben:
Der neue Output von DJOKO auf dem etablierten Dub-Techno-Label Berg Audio ist eine wahre Freude für die Ohren. Das Album Endless Explorations Pt. III besteht aus acht energiegeladenen Tracks, die verschiedene Subgenres des House und Techno bedienen. Der Titeltrack eröffnet die Platte mit eingängiger Percussion und tiefer Bassline, bevor sich schwebende Synths im Mittelteil aufbauen und in einem treibenden Break untergehen.
Der zweite Track ‘Cellular‘ führt das Album weiter, wobei die behutsam in den Track eingebauten sphärischen Elemente eine wunderschöne Atmosphäre schaffen. Auch ‘Cosmic Interference‘ und ‘Journey To Nowhere‘ bieten abwechslungsreiche Klanglandschaften, die es uns ermöglichen, sich in DJOKOs Universum zu verlieren …
Halt! Stopp! Genug davon!
Ob das generisches Geschwurbel oder eine beeindruckende Beschreibung ist, soll jede:r für sich beantworten. Ich hab die Platte ja nicht gehört! Nur so viel: Wer sich schon mal durch die Review-Spalten von Musikmagazinen geswiped hat, erkennt, dass sich die Bot-Rezension in Aufbau und Sprache dem Mitteilungsbedürfnis der meisten Musikfreunde ähnelt. „Energiegeladene Tracks”, „eingängige Percussion”, „schwebende Synths” – ich hab diese inhaltsleeren Metastasen persönlicher Kreativlosigkeit einmal zu oft gelesen, um darüber weitere Worte zu verlieren.
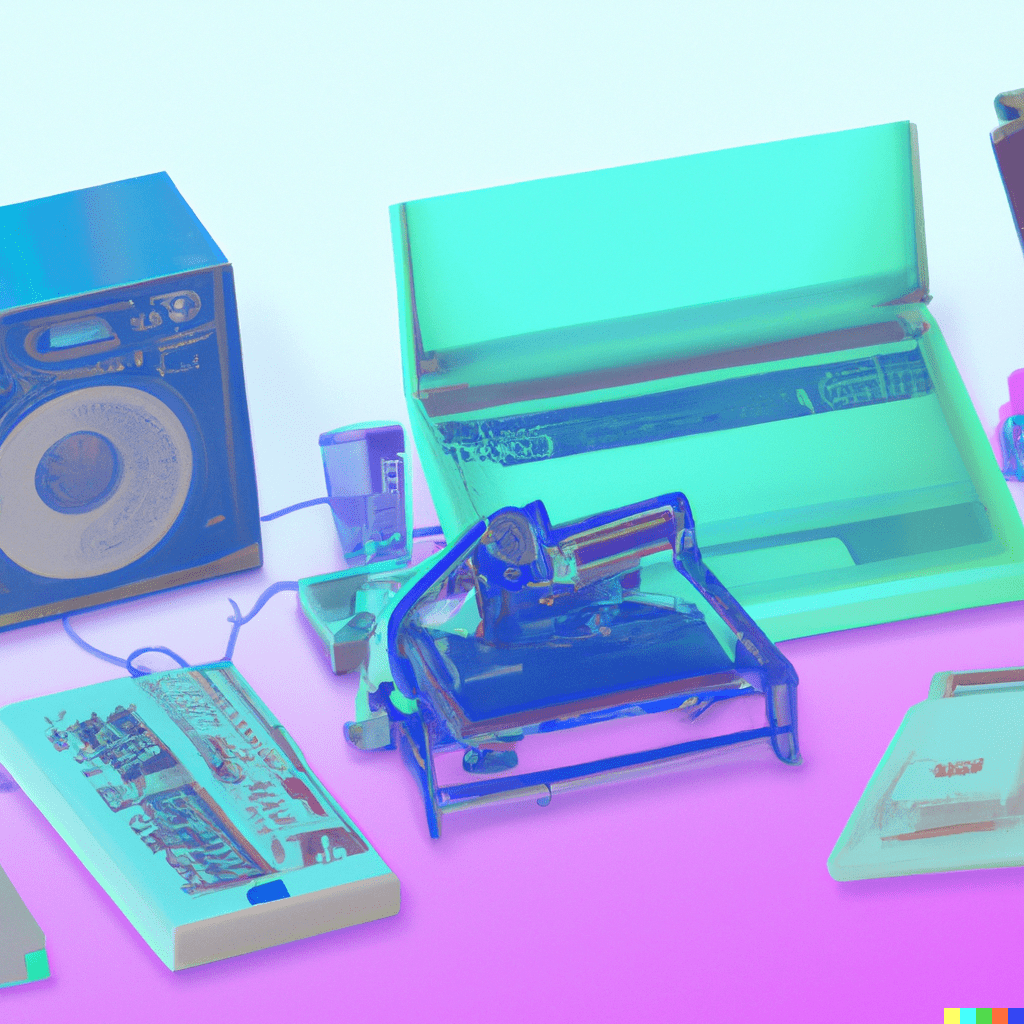
Schließlich mag ich zwar faul und uneitel sein, hab aber (k)einen Anspruch. Texte – vor allem solche kurze über Musik, weil die les ich bitteschön auf dem Klo – sollen mich unterhalten. Wer mir dagegen sprachliches Schlafmittel untermischt, bei dem sich sogar die Schreibe von Silberrücken aus dem FeUiLletOn wie eine Runde Tagada auf Ecstasy anfühlt, wird nie wieder geklickt. Nehmt es mir nicht übel: Das Leben zwischen zwei TikTok-Trends ist zu kurz für Texte, die ein trendiger Chatbot in „fünf Sekunden” generieren kann.
Was tun? Natürlich nichts! Ich kopiere den Text, den mir ChatGPT erstellt hat, korrigiere die Tracktitel und knall meinen Namen unter den Bums. Faul, uneitel, kein Anspruch – 1200 Zeichen seelenlose Scheiße gehen an meinen Arbeitgeber. Und: Dort fällt der Schwindel auf. Der Text schafft es nicht durch das Lektorat. Das sei doch nie und nimmer meine Sprache, heißt es. Ich bin erleichtert und lächle: „Ja, eh. Aber woher hat der Chatbot seine Antwort?”
Ich gebe zu, dass nicht ich, sondern der Computer diesen Text geschrieben habe. Mit ein paar Relativierungen erscheint er trotzdem auf der Homepage neben anderen Rezensionen und niemand stört sich daran. Wieso auch? Die Zeilen gehen unter, weil sie nichts aussagen. Und weil sie nichts aussagen, fallen sie nicht auf: Ist das nicht das große Problem in einem Feld, das die Regeln der Kritik verlernt hat, weil Kritik mit Cancelling verwechselt wird?
Ich will damit nicht sagen, dass die meisten Rezensionen schlecht sind. Ich sage, dass ihnen der Enthusiasmus einer Ikea-Anleitung anhaftet. Am Schlimmsten aber: Sie sind austauschbar wie der computergenerierte Rülpser eines Chatbots. Ich lese nochmal die Rezension, die ChatGPT über eine Dub-Techno-Platte verfasst hat. Würde man die Namen der Artists und Labels wechseln, was bliebe über? Eine Aneinanderreihung von Aussagen, die nichts aussagen. „Schwebende Synths, eingängige Percussion” – eher fresse ich alle Promo-E-Mails, die über die Dauer einer Woche in meiner Inbox landen, als dass ich mir diese Dampfgarer-Rezensionen reinziehe.
Manche werden argumentieren: Platten-Rezensionen sind nicht gleichzusetzen mit Musikjournalismus! Ich sage: Ja, stimmt! Solange gedruckte Gazetten mit zweistelliger Seitenzahl an Reviews werben und Online-Magazine jede Woche den verlängerten Tonarm von PR-Agenturen geben, haben sie aber großen Anteil daran. Selbst die besten Essays oder Reportagen können das nicht ändern, wenn ich nach zwei Zeilen über die neue Dettmann am Klo einpenn.
Das analytische Klugscheißertum war vielleicht 1997 in der Spex ein Ding. Seitdem hat sich die Welt weitergedreht. Mein 13-jähriger Neffe knallt sich in fünf Minuten mehr Musik rein, als ich an einem Tag höre. Das mag wenig mit Deep-Listening zu tun haben. Manch edler Ritter des Vergangenen wird sogar behaupten, dass es bei dieser Form des Konsums nicht mehr um die Musik gehe. Schließlich höre man nur Bruchstücke und Breaks, Momente und ihre Moods. Aber was hilft den Miesgrämer:innen diese Erkenntnis, wenn sie nicht schreiben wollen, dass DIESER EINE MASH-UP REINZUCKERT, ALS HÄTTE MAN GERADE ELF MATE-COLA AUF EX WEGGERÜSSELT!
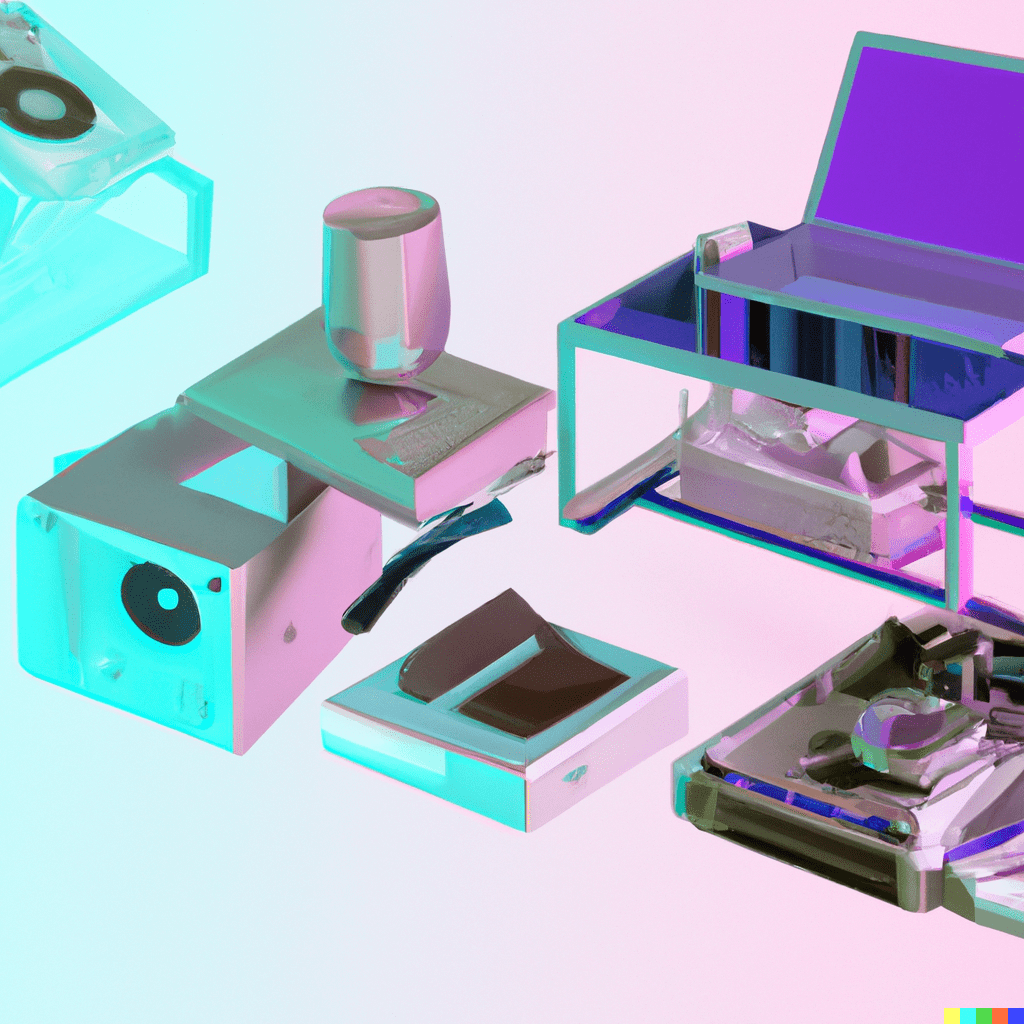
„Computer waren noch nie Instrumente der Vernunft, die die Probleme der Menschen lösen konnten”, sagt Ian Bogost. Sie seien lediglich Apparate, die die menschliche Erfahrung durch eine leistungsfähige Methode der Symbolmanipulation strukturieren. Das heißt: Wir haben unser Denken so weit gestreamlined, dass jeder Schulaufsatz, jedes Motivationsschreiben, jede Musikrezension und News den gleichen Mustern folgt. Dass ein Chatbot im Jahr 2022 diese Muster nicht nur erkennen, sondern besser zusammensetzen kann, überrascht mich so sehr wie ein Full-Body-Harness in der strengen Kammer.
Klar, in beiden Fällen mag das zu existentieller Bedrohung oder Begeisterung führen. Beide Fälle zeigen aber auch, wie langweilig, unkreativ und vorhersehbar wir geworden sind. Wir hätten keine Angst, dass Computer unsere Jobs wegnehmen, würden wir aufhören, wie Computer zu denken. Zerreißen wir die Muster, brechen wir mit der Konvention – und ziehen uns endlich den Schreibstock aus dem Hintern. Das würde nicht nur zu mehr Unterhaltung im Musikjournalismus führen. Es wäre auch die Zerstörung der Langeweile, die Computer inzwischen besser beherrschen als wir selbst.
Hier noch eine Offenlegung: Ich arbeite manchmal fürs Groove Magazin. Dort erschien die Rezension, die ChatGPT ausspuckte, mit kleinen Veränderungen unter meinem Namen. Ach ja: Die 14 Euro, die ich mit dem Schwindel verdient habe, gingen an meinen Straßenzeitungsverkäufer. Frohes Fest!





1 Kommentare zu "Künstliche Intelligenz im Musikjournalismus: Schluss mit den langweiligen Texten!"
Schön wie dieser Chatbot zur Selbstkritik anregt. Die Zukunft hat begonnen.
Hinterlasse eine Antwort
Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.