
Quartalsbericht – Q1 2023: Ein revolutionäres Streamingmodell und Pay-to-play bei Spotify
In seiner neuen Kolumne ‘Quartalsbericht’ ordnet Kristoffer Cornils alle drei Monate die wichtigen Nachrichten aus der Musikindustrie kritisch ein: Was ist im Big Business passiert und was bedeutet das für die kleinen Player? In der ersten Ausgabe geht es um ein „Artist-centric“-Ausschüttungsmodell im Streaminggeschäft und darum, wie Spotify aus Musiker:innen Werbetreibende machen will.
Fangen wir mit den guten Nachrichten an: Der Musikindustrie geht es blendend. Laut dem kürzlich veröffentlichten „Global Music Report“ machte die Branche im Jahr 2022 einen weltweiten Umsatz von 26,2 Milliarden US-Dollar aus dem Geschäft mit Musikaufzeichnungen, das heißt vor allem durch Streaming und den Verkauf von Tonträgern. Das sind neun Prozent mehr als im Vorjahr. Schon zuvor hatte der Bundesverband Musikindustrie (BVMI) gemeldet, dass allein in Deutschland mehr als zwei Milliarden Euro in diesem Segment umgesetzt wurden. Das entspricht einem Wachstum von 6,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zuletzt sahen die Zahlen vor zwanzig Jahren dermaßen gut aus. Ist ein neues goldenes Zeitalter angebrochen?
Jein. Die guten Nachrichten sind natürlich erstmal nur solche für all jene, die schon vorher am meisten vom Geschäft aus der Musik profitieren: Tech-Plattformen und Major-Labels. Mehr noch aber lassen sich aus diesen Zahlen bei genauerem Hinsehen vielleicht sogar schlechte Perspektiven herauslesen. Denn eine durchschnittliche weltweite Inflation von 8,7 Prozent im Jahr 2022 schmälert dieses Umsatzwachstum genauso, wie es in realen Zahlen hinter optimistischen Prognosen zurücklag. Darüber hinaus wurde im Tech- und Musikbereich in den vergangenen zwölf Monaten eine höhere fünfstellige Anzahl von Jobs gestrichen, zuletzt auch beim drittgrößten Major-Label Warner Music Group (WMG). Hat hier jemand „Rezession“ gesagt?
Die Branche muss also noch eine Schippe zulegen, wenn sie weiterwachsen oder zumindest den Status quo halten will. Mark Zuckerberg ist bestimmt nicht der einzige, der ein „Jahr der Effizienz“ anstrebt. Tatsächlich steht der erste Quartalsbericht für das Jahr 2023 unter dem Zeichen der (Kosten-)Effizienz: Das größte Major-Label will mit einigen weniger großen Streamingdiensten ein neues, angeblich Artist-zentriertes Ausschüttungsmodell entwickeln, während Künstler:innen vom Marktführer auf dem Streamingmarkt zur Kasse gebeten werden.
Universal, TIDAL, Deezer und Co.: Ein neues Ausschüttungsmodell?
Lucian Grainge ist der wohl mächtigste Mensch der Musikwelt. Als CEO der Universal Music Group (UMG) muss er sich also nicht dazu herablassen, bei anstehenden Umwälzungen im Streaminggeschäft eine Pressemitteilung zu veröffentlichen: Eine interne Memo an seine Untergebenen tut es auch. In der am 11. Januar geleakten Neujahrsansprache kündigte er an, dass sich UMG in Zukunft dem Aufbau eines „gesunden, nachhaltigen und aufregenden Ökosystems“ widmen wolle, in dem „unsere Künstler:innen in den kommenden Jahren und Jahrzehnten aufblühen können“.
Die Betonung liegt auf „unsere“, denn gemeint sind zweifelsfrei UMG-Artists und damit auch das Label an sich, das sich nicht unerhebliche Teile aus ihren Einnahmen abzwacken darf. Durchschnittlich 42 Prozent der Einnahmen aus dem Streaminggeschäft gehen laut einer neueren GEMA-Studie an Labels, wobei davon auszugehen ist, dass der Anteil von Major-Labels in der Regel noch höher sein dürfte. Das scheint in Grainges Augen aber nicht das zentrale Problem zu sein – wieso auch, der Mann durfte sich nach dem Jahr 2021 gut 300 Millionen US-Dollar als Bonus auszahlen.
Vielmehr geht es ihm um etwas anderes: Auf den gängigen Plattformen werde zu viel Schrott hochgeladen, der seinen armen Artists (lies: seinem Label, seinem Bonus) die Butter vom Brot nehme. Schon im Herbst 2022 ging die Nachricht herum, es würden mittlerweile täglich 100.000 Songs auf die Streamingdienste geladen. Diese Zahl hat übrigens er selbst in Verbund mit Steve Cooper vom drittgrößten Major, der Warner Music Group (WMG), ins Leben gesetzt. Die Realität sieht etwas komplexer aus.
Trotzdem insistiert Grainge in seinem Memo: „Das aktuelle Umfeld hat viele Leute angelockt, die eine wirtschaftliche Chance darin sehen, die Plattformen mit irrelevanten Inhalten zu fluten, die sowohl Künstler:innen als auch Labels die ihnen zustehende Vergütung rauben.“ Das klingt ein bisschen so, wie dereinst über Napster gesprochen wurde und ist ein bisschen sonderbar. Selbst wenn wir davon ausgehen, dass irgendwelche Firmen belanglose 31-sekündige Clips auf Spotify und Co. pumpen: Werden die wirklich gehört? Laut einem jüngeren Luminate-Bericht wurden 38 Millionen (!) der 158 Millionen (!!) auf Streamingplattformen erhältlichen Tracks nicht ein einziges Mal (!!!) gestreamt.

Andererseits meldete sich vor nur wenigen Tagen der CEO des UK-Vertriebs Horus Music, Nick Dunn, mit einem Op-Ed bei Music Business Worldwide zu Wort, um Grainge für seine klaren Worte zu applaudieren. Kurz darauf veröffentlichte dasselbe Magazin die Ergebnisse einer Studie, laut denen der Anteil von betrügerischen (heißt: von Clickfarms und anderen zwielichtigen Diensten generierte) Streams auf Spotify und Deezer sich im französischen Raum auf 1 bis 3 Prozent beläuft. Auch wenn das nach nicht viel klingt und nur für Frankreich gilt: Es ist zweifelsfrei zu viel. Der etwas alarmistischen Argumentation von Grainge und Co. zufolge nehmen Fake-Streams vor allem bei diesen beiden Plattformen anderen Künstler:innen das Geld weg, weil sie Tantiemen nach dem sogenannten Pro-Rata-Modell ausschütten.
Und das ist das, was Grainge eigentlich will: eine neue Alternative zum bestehenden System. Das Pro-Rata-Modell steht seit längerer Zeit in der Kritik, weil es Superstars mutmaßlich übervorteilt. Dieses Prinzip verteilt grob gesagt am Ende des Monats die Tantiemen entsprechend dem prozentualen Anteil am gesamten Streamingaufkommen. Wenn also beispielsweise innerhalb eines Monats von 100 Milliarden Streams in der Gesamtheit 20 Milliarden allein auf die Songs von Taylor Swift entfielen, erhalten T-Swizzle, ihre Labels und andere an den Songs beteiligten Rechteinhaber:innen 20 Prozent vom ganzen Kuchen.
Das klingt erstmal sinnvoll, ist aber eigentlich zweifelhaft. Wenn ich nämlich als Hörer den ganzen Monat ausschließlich das neue Album von upsammy gehört habe, gehen die zur Ausschüttung vorgesehenen Geldbeträge aus meinem Abo nicht komplett an upsammy, sondern … ja, eben: zu den größten Teilen an Taylor Swift, Bad Bunny, Miley Cyrus und Co. Deshalb denken viele, dass insbesondere unabhängige oder ihre Musik selbst vertreibende Künstler:innen das Nachsehen haben. Deshalb wurden über die Jahre die Rufe nach einem sogenannten „user-centric“-Modell immer lauter. Demzufolge ginge mein Geld dann direkt an upsammy. Eingeführt hatte ein solches Prinzip erst SoundCloud im April 2021, TIDAL folgte ihnen ein halbes Jahr später.
Nun ließe sich denken, dass der so um seine Künstler:innen besorgte Grainge ein solches Modell befürwortet. Falsch gedacht. Er hat sich etwas anderes ausgedacht, das in seinen Worten „allen Künstler:innen – DIY, Indie und Major“ dienlich sei. Deshalb spricht er von einem „artist-centric“-Modell. Nur: Was das konkret heißt und wie es funktioniert, das weiß noch niemand – vielleicht nicht einmal Grainge selbst. In den darauffolgenden Wochen sickerte aber immerhin durch, dass UMG nicht allein aus dem schönen Begriff ein konkretes Konzept entwickeln möchte: Zuerst verkündeten UMG und TIDAL ihre Zusammenarbeit an, wenig später wurde Deezer als ein weiterer Partner bestätigt. Dazu ließ Grainge nebenbei noch fallen, dass das neue Modell auf „alle Plattformen, darunter auch solche für Kurzform-Videos“ (TikTok, anyone?) angepasst werden soll.
TIDAL und Deezer sind insofern gute Partner für UMG, als sie bereits den Willen gezeigt haben, das „user-centric“-Modell auszuprobieren – auch wenn Deezer anders als TIDAL bisher nur darüber geredet und das Ganze nie in die Tat umgesetzt hat. Drei Größen in der Sorge um hart arbeitende Kreative vereint! So sieht es zumindest aus. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass es Grainge und diesen Plattformen wirklich darum geht, hart schuftende Indie-Musiker:innen fairer zu entlohnen?
Eher weniger, denn sonst würde Grainge vielleicht mal im eigenen Keller aufräumen: Sein Unternehmen muss sich derzeit einer Sammelklage stellen, in der Künstler:innen aus dem eigenen Kader zumindest 50 Prozent der Streamingeinnahmen von Spotify seit dem Jahr 2011 sowie die Hälfte des Anteilskapitals des Labels an dem Streamingdienst fordern. Und außerdem darauf verweisen, dass UMG niedrigere Tantiemenzahlungen mit Spotify ausgehandelt hatte, um überhaupt an diese Anteile zu kommen. Allein diese eine Klage – es ist derzeit nicht die einzige – beweist, dass UMG nicht mal die eigenen Künstler:innen fair entlohnen möchte.
Sie unterstreicht indes ebenso, dass nicht allein Spotify und Co. an den miesen Tantiemenauszahlungen im Streaminggeschäft schuld sind. Wann immer nämlich die Rede von den durchschnittlich 0,003 US-Dollar ist, die pro Stream bei Artists ankommen, muss bedacht werden, dass sich in der Regel Labels zuvor einen guten Teil davon abgeknapst haben – und dass es überhaupt erst die Majors waren, die gemeinsam mit Spotify und anderen Streamingdiensten diese Bezahlmodelle erst aufgebaut haben. Und nun wollen eben diese Firmen alles nochmal umwerfen und neu machen. Vielleicht wird’s also doch ein „major-centric“-Modell und womöglich sehen dann die von Grainge angerufenen DIY- und Indie-Artists noch weniger Geld.
Vielleicht geht es sogar insgesamt nur darum, dass hier riesige Firmen einer anderen einen reindrücken möchten. Denn womöglich will UMG einer Plattform Feuer unterm Hintern machen, auf der die Majors insgesamt so langsam ihren Marktanteil verlieren: Spotify scheint an der Entwicklung des „artist-centric“-Modells bisher nicht beteiligt. Womit wir beim nächsten leidigen Thema wären. Bei Daniel Eks Firma hat sich übrigens auch einiges getan. Ähnlich wie das Bohei um die Umwälzung im Ausschüttungsbereich ließe sich das wohl so zusammenfassen: Es ändert sich irgendwie alles, und für unabhängige und selbstvertreibende Künstler:innen natürlich zum Schlechten – im Grunde aber bleibt es wie zuvor.
Spotify: Endlich zahlen, um gehört zu werden!
Die Spotify-Aktie fuhr zuletzt Achterbahn und macht mittlerweile wieder auf einem Plateau Verschnaufpause. Immerhin steigen die Nutzerzahlen jedoch konstant an: Gut eine halbe Milliarde Menschen streamen sich dort monatlich durch Low-Res-Audio und 205 Millionen zahlen sogar dafür. Die weniger guten Nachrichten: Für das vierte Quartal meldete Spotify auf der Einkommensseite gewohnt tiefrote Zahlen und strich, weil das derzeit ja alle machen, 500 Stellen. Daniel Ek und seine Firmen sparen also ein, weshalb die Forderungen aus vor allem der unabhängigen Musikszene nach erhöhten Abopreisen – Deezer, Apple und Amazon haben es schließlich vorgemacht – wohl weiterhin auf taube Ohren stoßen werden, obwohl Ek etwas Ähnliches angedeutet hatte.
Doch selbst, wenn eine Erhöhung kommen sollte: Es ist unwahrscheinlich, dass die Rechteinhaber:innen von Musik tatsächlich mehr Geld sehen werden. Das gilt auch für die Plattformen, die diesen Schritt bereits gegangen sind. Denn obwohl noch keine belastbaren Zahlen dazu vorliegen: Amazon etwa wird wohl kaum die Abo-Preise für Musik erhöhen, damit Musikproduzent:innen mehr Geld erhalten, während im eigenen Haus erst 18.000 und dann nochmal 9.000 Stellen gestrichen werden. Auch bei Deezer und Apple hat vermutlich niemand das Ansinnen, den sprichwörtlichen Kuchen zur Tantiemenaufteilung zu vergrößern. Das Stichwort lautet wohl eher: Inflationsausgleich.

Aber zurück zum Marktführer. Als Ek und seine Firma am 8. März zu einer Präsentation zu den kommenden Neuerungen auf der Plattform einluden, war von alledem sowieso keine Rede. Stattdessen wurden nur hin und wieder Worte wie „Monetarisierung“ in den Raum geworfen. „Stream On“ war in erster Linie zweierlei Ankündigungen gewidmet. Zum einen wird der Home Feed von Spotify in Zukunft aussehen wie TikTok, zum anderen werden Musiker:innen dort endlich behandelt wie diejenigen, für die dieser Service immer schon gedacht war: Werbetreibende.
Schauen wir uns zuerst den audiovisuellen Turn der App an: Es handelt sich um einen vertikalen Feed mit Previews für Audio-Inhalte, Video-Snippets sowie von den sogenannten Creators, sprich Musiker:innen oder Podcast-Produzent:innen, erstellte Kurzvideos mit Blicken hinter die Kulissen und so weiter. Das Innovative an diesem Feature ist übrigens, dass diese Videos anders als anderswo nicht „Storys“, sondern „Clips“ heißen. Außerdem dürfen sie maximal nur 30 Sekunden lang sein und wir erinnern uns: Geld für den Play eines Musikstücks gibt’s erst ab 31 Sekunden.
Für Musiker:innen heißt das, dass sie in Zukunft unbezahlte Mehrarbeit leisten müssen, um im neuen audiovisuellen Wirrwarr sichtbar zu bleiben. Das könnte sich als Sisyphusarbeit herausstellen, weil der Fokus sowieso auf anderen Audio- beziehungsweise audiovisuellen Inhalten liegt. Neben Hörbüchern pusht das Unternehmen seit geraumer Zeit vor allem Podcasts, die mittlerweile auch im Video-Format – es muss ja nicht immer nur bei TikTok geklaut werden, hin und wieder ist YouTube auch okay – ausgespielt werden können. Abermilliarden von Euro hat Spotify zuletzt für Hörbuch- und Podcast-Technologie sowie exklusive Inhalte von Joe Rogan und anderen Sympath:innen ausgegeben. Warum aber eigentlich?
Weil das Geschäft mit der Musik für Spotify keines ist, oder besser gesagt ein Minusgeschäft. Je mehr Menschen dort immer mehr Musik hören, desto mehr Geld muss das Unternehmen in Form von Tantiemen abdrücken. Diese Ausgaben ließen sich durch zwei Maßnahmen im Zaum halten oder gar verringern: Entweder wird Musik durch andere Medien verdrängt, für die vergleichbare Kosten nicht anfallen, oder aber es wird mehr Geld durch das Kerngeschäft von Spotify eingefahren – Werbung. Wie gut, dass für Podcasts keine Tantiemen anfallen und sich in die Dinger auch noch Reklame einbinden lässt! Die übrigens wird seit geraumer Zeit auch zahlender Kundschaft ausgespielt.
Die Rechnung: Höre ich – um bei dem Beispiel zu bleiben und weil es wirklich toll ist – zweimal über Spotify das neue Album von upsammy am Stück durch, muss das Unternehmen in diesen rund 66 Minuten exakt 20 Mal einen Kleckerbetrag abdrücken. Wenn ich mich aber stattdessen von einem mehr als einstündigen Podcast über Turnschuhe in den Schlaf labern lasse, spart Spotify einerseits diese Ausgaben und verdient andererseits noch daran, mir zwischendurch Sneaker-Werbespots reinzudrücken. Auch ohne BWL-Abschluss sollte den meisten Menschen sofort verständlich werden, warum Podcasts für Spotify zum Nonplusultra geworden sind.
Auch interessant

Obwohl es sich dabei freilich um eine relativ neue Entwicklung handelt: Es war schon immer Sinn und Zweck von Spotify, Werbetreibenden ein Publikum zu eröffnen. Musik war dazu immer nur das gut ziehende Lockmittel, das mittlerweile zum schwierigen Kostenpunkt geworden ist und dementsprechend nicht mehr priorisiert wird. Was heißt das für die Musiker:innen? Dass sie mittlerweile nicht mehr einfach nur noch die inhaltlichen Lockstoffe bereitstellen, sondern eben selbst zu Werbetreibenden werden, die entweder auf Teile ihrer Tantiemen verzichten oder aber selbst in die Tasche greifen müssen, um ihr – dem Dienst auf eigene Kosten bereitgestelltes – Produkt auf der Plattform bekannt zu machen. „Pay-to-play“ oder auch „Payola“ ließe sich das nennen. Im Grunde aber ist es schnöde Werbung.
Im Rahmen von „Stream On“ priesen dann Ek und diverse Spotify-Mitarbeiter:innen ständig die Vorteile der Programme „Discovery Mode“ und „Marquee“. Beide sind umstritten und das völlig zurecht. Mit dem ersten können sich Künstler:innen und Labels bessere Platzierungen in algorithmisch erstellten Playlists erkaufen, indem sie auf ein paar Tantiemen verzichten. Weniger einnehmen, um – ganz eventuell vielleicht, Garantien gibt es natürlich keine – mehr gehört zu werden? Mit Marquee können sie derweil, analog zu den wie von etwa Facebook oder Instagram bekannten Kampagnen, Werbebanner ausspielen, um ihre (potenziellen) Fans auf neue Releases hinzuweisen. Kostenpunkt im deutschen Raum: Mindestens 100 Euro pro Kampagne, alles für ein bisschen Sichtbarkeit und keine garantierten Plays. Keine geilen Rechnungen, oder?
Podcasts und Hörbücher stehen also insgesamt mehr im Fokus von Spotify und werden dem Publikum wohl in Zukunft noch penetranter vermarktet – auch wenn sicherlich viele Abonnent:innen genau deswegen monatlich in die Tasche greifen, um vor Werbung verschont zu bleiben. Darüber hinaus wird dank des neuen Home Feeds sichergestellt, dass der Kampf um (buchstäbliche) Sichtbarkeit in Zukunft mit noch härteren Bandagen gekämpft wird. Das erhöht den Handlungsdruck vor allem auf unabhängige und selbstvertreibende – von denen selbst die bestverdienenden mittlerweile weniger einnehmen – Künstler:innen. Und macht sie damit umso ausbeutbarer.
Was tun? Proteste gegen Spotify wären allein deswegen wirkungslos, weil unabhängige und selbstvertreibende Künstler:innen für das Unternehmen eher eine Belastung denn eine Bereicherung darstellen und daher keine Handhabe haben. Sinnvoller wäre es, neue Alternativen auf- oder bereits bestehende auszubauen. Vielleicht braucht es mehr von Künstler:innen mitgestaltete Streamingplattformen wie Resonate. Dessen Modell ließe sich wohl gut und gerne als „artist-centric“ beschreiben.

Was sonst noch wichtig war:
Alphabet hat das super-mega-erfolgreiche und überhaupt gar nicht unbeliebte Feature YouTube Shorts endlich doch ein bisschen attraktiver gemacht: Seit Februar können Rechteinhaber:innen damit Geld verdienen. Das macht Alphabet wohl nur, um den Konkurrenzdruck auf TikTok (siehe unten) zu erhöhen. Besser als die ByteDance-App oder eben Spotify mit seinen neuen Stor…, äh, Clips (siehe oben) ist es indes schon.
Apple steht mal wieder oder besser gesagt immer noch unter Beschuss für die halsabschneiderischen Gebühren in seinem App-Store, besonders lautstark zuletzt durch Deezer und Spotify. Siehe da: Wenn ein Daniel Ek selbst betroffen ist, interessieren ihn Ungerechtigkeiten plötzlich.
Aslice und der Promo-Dienst Fatdrop machen nun gemeinsame Sache – und lösen damit ein Problem, das die GEMA vermutlich nicht einmal als solches erkennt: Für vor der Veröffentlichung verschickte und im Club gespielte Musik können in der Regel keine Tantiemen ausgeschüttet werden. Eine schöne Neuerung für das Programm, das trotz einiger Problemchen absolut unterstützenswert bleibt.
Bandcamp ermöglicht die Erstellung von Playlists zum Streamen von gekaufter Musik in der hauseigenen App und wurde nun, es war vorauszusehen, als eine Art Radio in den Epic-Games-Kassenschlager Fortnite eingebettet. Ein paar ausgewählte Bands und Künstler:innen erhalten dank der dort ausgespielten elf Songs eine riesige Reichweite – aber erhalten sie auch Tantiemen für die Wiedergabe ihrer Musik? Ein Jahr nach der freundlichen Übernahme von Bandcamp durch den Gaming-Riesen gründete sich außerdem eine hauseigene Gewerkschaft. Glück auf, Genoss:innen!
Beatport hat die Mehrheitsanteile am Business-Techno-Branchentreff International Music Summit (IMS) gekauft und ist obendrein im Jahr 2021 angekommen, hat also eine NFT-Plattform gelauncht. Ich wünsche einen milden Kryptowinter.
DuoLingo plant anscheinend eine Musiklern-App. Irgendwie cool!? Zugleich ist Musikunterricht aber ein weiteres der durchschnittlich zwei Dutzend Standbeine, mit denen sich viele Musiker:innen aufrecht halten. Sollte das dank einer großen Tech-Firma nun in Einzelfällen wegbrechen: nicht so cool.
Live Nation beziehungsweise Ticketmaster steht – ganz was Neues – wegen mutmaßlicher Wucherei in der Kritik. Zuletzt regte sich Robert Smith darüber auf, dass das Unternehmen dem Wunsch seiner Band The Cure zwar nachkam, für ihre kommende Tour auf sogenanntes dynamisches Preismanagement (wie bei Uber und der Deutschen Bahn: je mehr Nachfrage, desto mehr kostet’s) zu verzichten – aber dafür eine ganze Menge Gebühren draufschlug. Keine gute PR für eine Firma, die aktuell vom US-amerikanischen Justizministerium belagert, von den Swifties sowie anscheinend nun auch Drake-Fans verklagt wird und trotzdem die Frechheit besitzt, einen sogenannten FAIR Ticketing Act vorzuschlagen.
Meta hat einfach mal die komplette Musik von italienischen Komponist:innen von den hauseigenen Plattformen – Facebook, Instagram, die Älteren werden sich erinnern – gekickt. Geld sparen einerseits, Macht beweisen andererseits: Der Zuckerberg kann’s noch! Und der Pöbel soll derweil doch Kuchen essen.
SoundCloud hat einen neuen CEO und ist mittlerweile wie alle anderen drauf und dran, TikTok zu kopieren.
TikTok selbst hat in Australien die Musik von Major-Labels von der Plattform entfernt und dort zugleich das eigene Vertriebssystem SoundOn an den Start gebracht, um die Musikindustrie erst recht zu umschiffen. Ist nicht so gut gelaufen. Das deutet an, dass die Majors und TikTok beziehungsweise das dahinterstehende Unternehmen ByteDance einander doch brauchen und vielleicht bald ihre Gespräche zur Musiklizenzierung vertiefen könnten. Wer eine Allianz zwischen Spotify und den Majors beziehungsweise UMG und diversen Plattformen (siehe oben) schon kritisch sieht: Keine Sorge, schlimmer geht immer. Sollte allerdings ein Verbot der App nach dem Vorbild Indien in den USA oder anderswo umgesetzt werden, würden die Karten neu gemischt.
Twitter wird hingegen wohl so schnell keine Lizenzvereinbarung mit den Majors abschließen. File under: Die Liegen auf dem Sonnendeck der Titanic sind ausgebucht.
Vinyl läuft weiterhin gut. Nur das Pressen bleibt für unabhängige Künstler:innen und kleinere Labels weiterhin schwierig und extrem kostspielig. Immerhin der nebenbei hobbymäßig als Metal-Band aktiven Musikfirma Metallica macht das nichts aus: Sie haben ein eigenes Presswerk gekauft. Alle anderen schauen in die Röhre. Aber was ist auch zu erwarten von einer Gruppe, die einst gezielt ihre eigenen Fans ausbeutete?
Winamp hatte bereits letztes Jahr angekündigt, mit Winamp Creators einen One-Stop-Shop für Künstler:innen an den Start zu bringen: Wie zum Beispiel SoundCloud oder TikTok (siehe oben) ermöglicht die Plattform den digitalen Vertrieb der eigenen Musik und bietet noch viele weitere Features wie beispielsweise eine Patreon-ähnliche „Fanzone“, Rechte- und Lizenz-Management sowie den Verkauf von NFT. Das ist das vielleicht umfangreichste Angebot dieser Art auf dem Markt, obwohl irgendwie niemand darüber zu reden scheint. Wo seid ihr, Millennials?



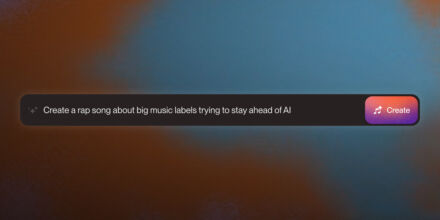

0 Kommentare zu "Quartalsbericht – Q1 2023: Ein revolutionäres Streamingmodell und Pay-to-play bei Spotify"